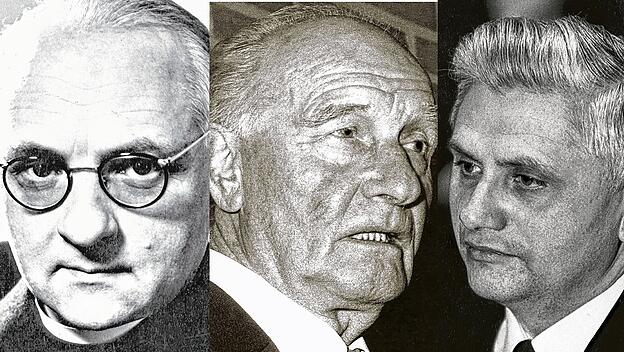"Die Kirche lebt von der Eucharistie.“ Mit diesem Grundakkord beginnt die letzte Enzyklika Johannes Pauls II. Ecclesia de Eucharistia. In diesem Vermächtnis seines langen Pontifikates schreibt er den ökumenisch umstrittenen Satz: „Die Feier der Eucharistie kann aber nicht der Ausgangspunkt der Gemeinschaft sein, sie setzt die Gemeinschaft vielmehr voraus und möchte sie stärken und zur Vollendung führen.“ (35) Wie können wir heute dem immer stärker werdenden Ruf nach Einheit gerecht werden?
In Bezug auf die Ostkirchen hat Joseph Ratzinger in den 70er Jahren die gewichtige These aufgestellt: „Rom muss vom Osten nicht mehr an Primatslehre fordern, als auch im ersten Jahrtausend formuliert und gelebt wurde.“ Sehr umstritten hingegen war – fast zeitgleich und in Blick auf die reformatorischen Kirchen formuliert – Karl Rahners „erkenntnistheoretische Toleranz“, die besagt, dass in keiner „Teilkirche“ „dezidiert und bekenntnismäßig ein Satz verworfen werden“ dürfe, der in der anderen Konfession ein „verpflichtendes Dogma“ ist. Entscheidend sei demnach die gegenseitige Toleranz und nicht mehr die Frage nach der Wahrheit. Seither werden diese Fragen nach Kirche, Eucharistie und Amt noch kontroverser diskutiert.
Kernthema Rechtfertigung
Der offizielle katholisch-lutherische Dialog hatte seit dem Vaticanum II die beiden Hauptthemen „Rechtfertigung“ als lutherisches Kernthema und konkret fassbare „Kirche“ als katholisches Anliegen. Die Unterzeichnung der Gemeinsamen Erklärung zur Rechtfertigungslehre am 31. Okt. 1999 in Augsburg hat einen gewissen Schlusspunkt unter die Behandlung des Rechtfertigungsthemas gesetzt. Damit sind allerdings nicht, wie manchmal der Eindruck vermittelt wird, auch die ekklesiologischen Fragen weitgehend gelöst, sondern die Beschäftigung mit ihnen steht noch aus, wie der Text der Gemeinsamen Erklärung zur Rechtfertigungslehre (Anm. 9 und Nr. 43) belegt.
Nach katholischem Verständnis (vgl. Nr. 18) ist dabei die Rechtfertigungslehre nicht das exklusive Kriterium, um zu ekklesiologischen Ergebnissen zu kommen. Der damalige Bischof Karl Lehmann hatte in seinem Eröffnungsreferat zur Herbstvollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz von 1998 erklärt: „Die Katholiken scheuen nicht die Betonung des einzigartigen Heilshandelns Gottes, sondern fürchten in der extremen Zustimmung auf die Rechtfertigungslehre als Kriterium aller theologischen Aussagen und aller kirchlichen Erscheinungen, besonders auch im Blick auf die Kirche, die Sakramente sowie die Ämter und Dienste, deren fragwürdige spirituell-theologische Entleerung und extreme Relativierung.“
Taufe und Eucharistie
Wenn das katholische und orthodoxe Zentralthema im ökumenischen Gespräch die Kirche ist, dann sind Taufe und Eucharistie die beiden Grundsakramente (vgl. Johannes 19,34). Die Feier der Eucharistie setzt Tod und Auferstehung Jesu gegenwärtig und voraus. Von daher ist es wohl irrig zu behaupten, dass neben dem letzten Abendmahl die vielfältigen Tischgemeinschaften mit Zöllnern und Sündern wie der Spottvers Matthäus 11,19 belegt, direkt auf die Eucharistie bezogen wären. Immerhin gilt, dass diese Tischgemeinschaften Jesu sich auf jüdische Zeitgenossen beschränken. So „offen“ waren demnach diese Mahlgemeinschaften Jesu nie.
Maßstab und Referenz jeder Reflexion über das Verhältnis von Kirche und Eucharistie ist der erste Korintherbrief. Paulus weiß um eine Vielzahl von Gruppen in der Gemeinde von Korinth, die sich gegenseitig befehdeten. In 1 Korinther 11,17f.20 erklärt Paulus, dass die Feier des Herrenmahls unter den Bedingungen der Spaltung dem Wesen des Auftrages Jesu widerspricht: „Zunächst höre ich, dass es Spaltungen unter euch gibt, wenn ihr als ,Ecclesia‘ zusammenkommt, … was ihr bei Euren Zusammenkünften tut, ist keine Feier des Herrenmahles mehr…“ Interessanterweise sagt Paulus also nicht: Wenn ihr in verschiedene Gruppen gespalten seid, feiert nur das Herrenmahl, dann wird das Problem schon durch die Feier gelöst!
Das Herrenmahl ist für ihn nicht der Weg, eine vorher nicht bestehende Einheit herzustellen. Eucharistie zu feiern, sich miteinander zu versöhnen, die Gemeinschaft mit Christus und untereinander zu proklamieren, den gemeinsamen Glauben zu bekennen, dann aber im Alltag in unterschiedliche, voneinander getrennte Gemeinschaften auseinanderzugehen, ist für Paulus ein Verrat am Evangelium (vgl. Matthäus 6,12.14f). In diesem Sinne hatte Christoph Kardinal Schönborn vor einigen Jahren darauf hingewiesen, dass ein Mensch, der den eucharistischen Leib des Herrn mit dem Wort „Amen“ empfängt, dies nur dann tun sollte, wenn er auch ein großes „Amen“ zu dem im Hochgebet ausgedrückten Glauben der Kirche sprechen kann. Dieser katholische Glaube beinhaltet im Sinne der drei „vincula“ Robert Bellarmins (Glaubensbekenntnis, Sakramente, kirchliche Leitung) eben auch das Bekenntnis zu der (nach katholischer Auffassung) von Gott gewollten bischöflichen Struktur der Kirche.
Divergierende Bekenntnisse schließen sich aus
Kirchengemeinschaft bedeutet deshalb immer Eucharistiegemeinschaft und umgekehrt. In diesem Sinne äußerte sich auch die evangelische Tradition einhellig bis 1973 (also bis zur „Leuenberger Konkordie“). Der lutherische Systematiker Werner Elert (†1954) drückte das so aus: „Durch die Teilnahme am Abendmahl einer Kirche bezeugt der Christ, dass das Bekenntnis dieser Kirche auch sein Bekenntnis ist. Weil man nicht zwei divergierenden Bekenntnissen zugleich zustimmen kann, darum kann man nicht in zwei bekenntnisverschiedenn Kirchen kommunizieren. Wer es trotzdem tut, verleugnet entweder das eigene Bekenntnis oder er hat überhaupt keines.“ Die Zusammengehörigkeit von Eucharistiegemeinschaft und Kirchengemeinschaft ist für die katholische und die orthodoxe Tradition Konsens, wie auch für viele freikirchliche, hochkirchlich-lutherische und anglokatholische Gemeinschaften.
Was ist Referenzpunkt des Gewissens?

Nach dem katholischen Kirchenrecht und auch in verschiedenen ökumenischen Texten der Katholischen Kirche wird grundsätzlich festgehalten, dass das Bekenntnis zum katholischen Glauben die Voraussetzung für den Kommunionempfang nicht katholischer Christen und Christinnen im Rahmen der katholischen Liturgie ist. Wenn in neueren Stellungnahmen einzig eine Gewissensentscheidung verlangt wird, erhebt sich die Frage nach dem Referenzpunkt des subjektiven Gewissens.
Dabei wäre die Rückbesinnung auf die biblischen und patristischen Wurzeln des Credo, der sakramentalen Struktur und der apostolischen Leitung ein objektives Kriterium der Unterscheidung. In den gegenwärtigen Kontroversen darf die Frage nach der offenbarten Wahrheit nicht ausgespart bleiben, da sonst die Kommunion zu einem vermeintlichen Symbol der Toleranz ohne jede Verbindlichkeit verflachen würde: „Der echte Ökumenismus ist ein Gnadengeschenk der Wahrheit“ (Johannes Paul II.). Nur in dieser Demut gegenüber der Wahrheit erfüllen wir den Auftrag Jesu: „Lass alle eins sein … damit die Welt glaubt, dass Du mich gesandt hast.“ (Johannes 17,21)
Zeugnis für die Wahrheit
Vor dem Gericht des Pilatus legt Jesus das Zeugnis für diese Wahrheit ab, für die er sein Leben hingibt. Seither sind viele um seines Namens Willen gehasst worden und haben ihr Leben als Märtyrer hingegeben, indem sie nach seinem Vorbild für ihre Peiniger gebetet haben. Dieses Blutzeugnis einer vergebenden Liebe ist, wie Papst Franziskus es in Bezug auf die Christenverfolgung darlegt, ökumenisch: „Für die Verfolger sind wir nicht geteilt, sind wir nicht Lutheraner, Orthodoxe, Protestanten, Katholiken… Nein! Wir sind eins! Für die Verfolger sind wir Christen! Etwas anderes interessiert nicht. Das ist die Ökumene des Blutes, die heute gelebt wird.“
Heinrich Schlier war als Konvertit von der um sich greifenden „erkenntnistheoretischen Toleranz“ so sehr erschüttert, dass er seine Tätigkeit als Herausgeber der ,Quaestiones Disputatae‘ mit dem 100. Band beendete – im Horizont der gemeinsamen Suche nach der theologischen Wahrheit schien ihm eine Fortsetzung seiner Mitarbeit nicht mehr vertretbar zu sein. Für Kardinal Koch, den Präsidenten des Päpstlichen Rats zur Förderung der Einheit der Christen, bleibt jedoch der Weg der Ökumene unumkehrbar. Im Gebet und im Opfer für diese Einheit (vgl. das Leben und Sterben der Sel. Gabriella Sagheddu) können oft größere Fortschritte gemacht werden, denn es ist Gott selber, der das Wann und das Wie der Einheit als Geschenk verleihen wird.
Maximilian Heim ist Abt der Zisterzienserabtei Heiligenkreuz. Er wurde über die Ekklesiologie Joseph Ratzingers promoviert und lehrte an der Hochschule Heiligenkreuz Fundamentaltheologie.
Die Printausgabe der Tagespost vervollständigt aktuelle Nachrichten auf die-tagespost.de mit Hintergründen und Analysen.