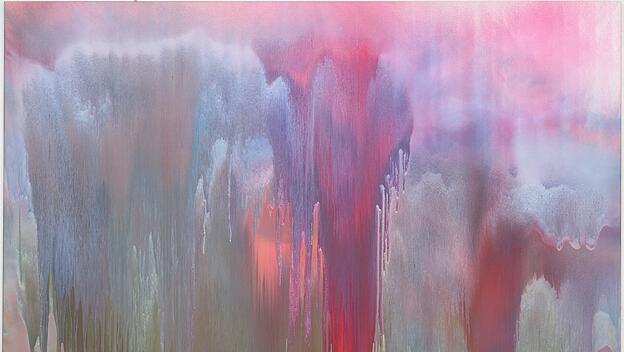Berlin, 21. Mai 2015, 19:00 Uhr: Im Haus der Berliner Festspiele wird der "Ambassador of Conscience Award" an die amerikanische Musikerin Joan Baez und den chinesischen bildenden Künstler Ai Weiwei verliehen. Der undotierte Preis für "Botschafter des Gewissens" wird seit 2003 jährlich von Amnesty International an Persönlichkeiten vergeben, die sich durch "außergewöhnlichen Führungsstil und Einsatz im Kampf für den Schutz und die Förderung der Menschenrechte" verdient gemacht haben.
Doch Ai Weiwei ist verhindert. Der chinesische Künstler steht nach einer viermonatigen Inhaftierung wegen "regierungsfeindlicher Äußerungen" seit 2011 unter Hausarrest und darf das Land nicht verlassen. Statt seiner begrüßt der Kurator und Laudator Chris Dercon seinen Sohn, der zusammen mit der Mutter auf die Bühne gekommen ist. Wer damals miterlebte, wie der 6-jährige Ai Lao den Preis für seinen Vater entgegennahm, wird die Szene nie vergessen. Im Sommer desselben Jahres wird Ai Weiwei die Ausreise nach Berlin gestattet, seither lebt er in Europa und macht auch dort aus seinem Herzen keine Mördergrube:
„China hat die Heuchelei und Untätigkeit des Westens in Menschenrechtsfragen gesehen,
deshalb sind sie noch kühner, skrupelloser und rücksichtsloser geworden.“
"Ideologische Säuberung (...) existiert nicht nur unter totalitären Regimes sie ist, in anderer Form, auch in liberalen, westlichen Demokratien vorhanden. Unter dem Einfluss extremer politischer Korrektheit werden individuelles Denken und Meinungsäußerung allzu häufig gegängelt und durch hohle politische Phrasen ersetzt."
Um das für viele Menschen befremdliche Verhalten des unbequemen, mit etlichen Preisen für sowohl sein künstlerisches Werk als auch für seinen Kampf gegen Ungerechtigkeit ausgezeichneten Konzeptkünstlers zu verstehen, muss man zurückgehen in das China der 60er Jahre. Ai Weiwei wurde 1957 in Peking geboren, als Sohn des in China sehr bekannten Dichters, Malers und Regimekritikers Ai Qing (1910-1996). Ai Qing, der in Paris studiert hatte, trat 1932 einer linken Künstlervereinigung bei und wurde Kommunist. 1958 übte er im Zuge der "Hundert-Blumen-Bewegung" Kritik am kommunistischen Regime (und damit an Mao Zedong) und wurde als "Rechtsabweichler" für 20 Jahre in die Verbannung geschickt.
Im Umerziehungslager Fähigkeiten zum Überleben angeeignet
1967 kam er zur "Umerziehung" in ein paramilitärisches Lager. Frau und Tochter ließ er zurück, der fast 10jährige Ai Weiwei und sein 15jähriger Stiefbruder begleiteten den Vater und teilten für 5 Jahre sein hartes, karges Leben am Rand der Wüste in "Klein Sibirien". Hier entwickelte der Junge die Fähigkeit, katastrophale Umstände als gegeben hinzunehmen und ihnen gleichzeitig etwas entgegenzusetzen, indem er mit Fantasie und Pragmatismus versuchte, dem Vater das Leben zu erleichtern. Dabei erwarb er eine geistige Stärke und Unabhängigkeit, die ihn für sein weiteres Leben furchtlos machen sollte.
Mao starb 1976, die Kulturrevolution war vorüber und Deng Xiaoping wurde 1977 von der Partei als Führer eingesetzt; die Opfer und damit auch Ai Qing der Kampagne gegen "Rechtsabweichler" wurden rehabilitiert. Ai Weiwei begann in dieser kurzen Phase des Tauwetters zu malen und studierte ab 1978 Zeichentrickfilm an der Pekinger Filmakademie, passte jedoch genauso wenig in die postmaoistische Ordnung wie in die maoistische zuvor. "Ich spürte, dass in meinen Venen ungezügeltes Blut floss: Es strömte aus der endlosen Wüste, aus den weißen Salzebenen, aus dem pechschwarzen Erdloch und der Hilflosigkeit jener langen demütigenden Jahre."
Schock über das Massaker auf dem Tian'anmen-Platz
Er wollte weg aus China, möglichst weit. 1981 wurde ihm ein selbstfinanzierter Studienaufenthalt in New York genehmigt. Bis 1993 blieb er, beschäftigte sich mit Performance, Konzeptkunst, Dadaismus und Popart und lernte deren Vertreter kennen Andy Warhol, Jean-Michel Basquiat, Keith Haring, Allen Ginsberg -, hielt sich mit Jobs über Wasser, begann zu fotografieren und hatte erste kleine Ausstellungen. Und erfuhr im Juni 1989 schockiert von dem Massaker am Tian anmen-Platz in Peking. Ai Weiwei trat mit Künstlerfreunden vor dem Gebäude der Vereinten Nationen in einen Hungerstreik, sie organisierten einen Marsch und Wohltätigkeitsauktionen zugunsten der Studenten und reichten einen Protestbrief beim chinesischen Konsulat ein.
1993 wegen einer schweren Erkrankung seines Vaters nach Peking zurückgekehrt, begann der Künstler, sich mit der traditionellen chinesischen Kunst und spirituellen Gegenständen zu befassen, deren Elemente Teil seiner Installationen wurden.
Kontakte zur westlichen Kulturszene und zur Politik
Die Begegnung mit dem damaligen Schweizer Botschafter in China, Uli Sigg, sollte Ai Weiweis Leben wieder einmal wenden. Sigg sammelte zeitgenössische chinesische Kunst und lud einflussreiche europäische Kuratoren nach Peking ein, die den Künstler zur Biennale nach Venedig brachten.
In Peking entwickelte sich Ai Weiwei auch zum gefragten Architekten, gipfelnd im Entwurf des Nationalstadions (dem sogenannten "Vogelnest") für die Olympischen Spiele in Peking 2008, gemeinsam mit Jacques Herzog, Pierre de Meuron und Li Xinggang. In der Entwurfsphase an der er mitwirkte - hatte Ai gehofft, dass die Gitterform des Stadions und die Präsenz der Olympischen Spiele Chinas neue Offenheit symbolisieren würden.
Trügerischer Gedanke: vor der Verfolgung des Regimes geschützt zu sein
Diese Hoffnung wurde enttäuscht. Das Stadion symbolisiert für ihn mittlerweile ein "falsches Lächeln". Die diesjährigen Winterspiele, die hier am 4. Februar eröffnet werden, geben dem Künstler Anlass zu bitteren Kommentaren: "China hat die Heuchelei und Untätigkeit des Westens in Menschenrechtsfragen gesehen, deshalb sind sie noch kühner, skrupelloser und rücksichtsloser geworden."
Der Beginn des Internetzeitalters stellte für Ai Weiwei eine Offenbarung dar, die ihn allerdings bald in den Fokus der Regierung rücken sollte: "Ich trat mit der Wucht eines Gewehrschusses in das Blickfeld der Öffentlichkeit." 2005 erschien sein erster Blog, dem unzählige folgen sollten. An die permanente Überwachung seines Ateliers und seines täglichen Lebens gewöhnt, kam die Verhaftung im April 2011 auf dem Flughafen aber doch überraschend für den Künstler. Er wird in eines der berüchtigten Geheimgefängnisse verbracht und bleibt dort für 81 Tage unter dem Vorwand der Steuerhinterziehung (den täglichen Ablauf in dieser Zeit schildert Ai Weiwei detailliert in seiner Autobiografie "1000 Jahre Freud und Leid").
Kunst, die betroffen macht und berührt
Internationale Proteste, angebotene Professuren aus Europa, seine Aufnahme in die Akademie der Künste Berlin bewirken wenige Tage vor dem Staatsbesuch des chinesischen Ministerpräsidenten in Berlin seine Freilassung auf Kaution, mit der Auflage, Peking nicht zu verlassen. Er soll 2,4 Millionen Dollar Steuerschulden nachzahlen, die über Spenden aus aller Welt auf seinem Konto eingehen. Ai Weiwei bezahlt, um dann in die Revision zu gehen – die erwartungsgemäß abgelehnt wird.
Ai Weiweis Kunstwerke, die immer Ausdruck gesellschaftlicher und politischer Missstände sind, die ihren Schöpfer zutiefst bewegen, vor allem, wenn Kinder betroffen sind, haben ihren Platz an Orten der ganzen Welt gefunden. "Namelist" mit den Namen der 5196 Schülerinnen, die 2008 beim Sichuan-Erdbeben ums Leben kamen. "6000 Hocker" in Berlin 2014. 1001 Holzstühle zur Documenta 2007. Das Flüchtlingsboot in Prag 2017.
Es gibt eine Kontinuität zwischen Vater und Sohn
"Sunflower Seeds" 2010 in London. Weil die Kunst die Wahrheit offenbart, die tief im Herzen liegt, kann sie eine machtvolle Botschaft vermitteln, sagt Ai Weiwei. Und in seinem Herzen liegen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, symbolisiert durch seinen Vater, ihn selbst und seinen Sohn. In ihrer Kontinuität ergeben sie ein kraftvolles Ganzes, in dem keine Erinnerung verlorengeht. Das ist der spirituelle Gedanke, der den Künstler antreibt.
"Ohne den Klang menschlicher Stimmen, ohne Wärme und Farbe in unserem Leben, ohne fürsorgliche Blicke ist die Erde nur ein empfindungsloser Fels im Weltraum."
Die Printausgabe der Tagespost vervollständigt aktuelle Nachrichten auf die-tagespost.de mit Hintergründen und Analysen.