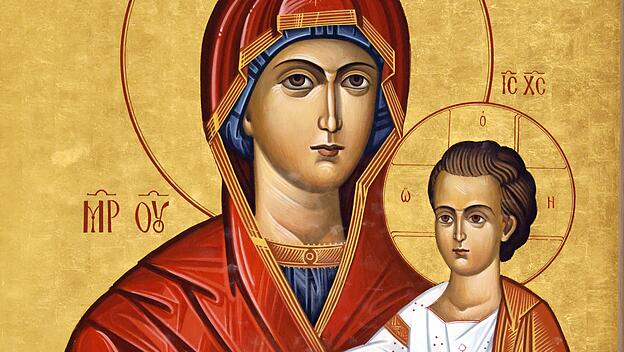„Die vernünftige Struktur der Materie, die uns in den erstaunlichen Gesetzen der Natur begegnet, spricht deutlich von einem Schöpfer und seinem ordnenden Geist.“ Das schrieb niemand Geringeres als Joseph Ratzinger, der spätere Papst Benedikt XVI., in seiner „Einführung in das Christentum“. Johannes Kepler (1571-1630) bezeichnete sich noch im 17. Jahrhundert als „Priester am Buch der Natur“.
Galileo Galilei (1564-1642) war überzeugt, „die Heilige Schrift und die Natur“ gingen gleichermaßen aus dem Logos hervor: „die eine als Diktat des Heiligen Geistes, die andere als gehorsame Vollstreckerin des göttlichen Wortes“. Im Mittelalter verfocht Bonaventura (1221-1274) die Ansicht: „Die Schöpfung selbst ist wie ein Buch, das die Weisheit, Güte und Macht Gottes offenbart.“
Das „Buch der Natur“ hat sich nicht selbst geschrieben
Und schon Augustinus (354-430) vermerkte in „De civitate Dei“: „Denn die ganze sichtbare Welt ist wie ein Buch, geschrieben von Gottes Finger, das den Menschen zum Lesen gegeben ist, um sie von den sichtbaren Dingen zu den unsichtbaren hinzuführen.“ Noch Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832), fasziniert vom Pantheismus Baruch Spinozas (1632-1677), schrieb 1774: „Sieh, so ist die Natur ein Buch lebendig, unverstanden, doch nicht unverständlich.“
Anders formuliert: Die „Zwei-Bücher-Lehre“, nach der sich Gott außer in der Heiligen Schrift, dem „Buch der Bücher“, auch im „Buch der Natur“, zu erkennen gibt, war zumindest unter den Intellektuellen lange Zeit Allgemeingut. Erst der Aufstieg des Naturalismus, dessen Wurzeln zu den Vorsokratikern zurückreicht und der das Glaubensbekenntnis des Atheismus darstellt, änderte das.
Seit den Entdeckungen Charles Darwins (1809-1882) wird er häufig mit den Naturwissenschaften gleichgesetzt. Das ist insofern fatal, als der Naturalismus „glaubt“, das „Buch der Natur“ habe sich selbst geschrieben. Nur: Wie es das getan haben soll, vermögen seine Anhänger nicht zu zeigen.
Wundern muss das nicht. Denn: Schriebe das „Buch der Natur“ sich selbst, hätte es auch uns geschrieben; genauso absichtslos, wie sich selbst.
Dass wir gleichwohl in der Lage sind, dieses Buch, in dem wir selbst kaum mehr als eine Zeile ausfüllen, in weiten Teilen zu entziffern, wirft zumindest Fragen auf. Fragen, die sich mit der Annahme von Zufällen nicht zufriedenstellend beantworten lassen.
Nun scheint die Erzählung des Naturalismus an ihr Ende zu gelangen. Immer mehr Physiker, Chemiker und Biologen, darunter auch Atheisten, erkennen bei den immer tiefer reichenden Untersuchungen dieses Buches, dass es sich unmöglich selbst verfasst haben kann.
„Auf dem Grund des Bechers wartet Gott"
Um es mit dem Physiker Werner Heisenberg (1901-1976) zu sagen: „Der erste Trunk aus dem Becher der Naturwissenschaften macht atheistisch, aber auf dem Grund des Bechers wartet Gott.“ Dieser Gott ist kein „Lückenbüßer-Gott“, sondern der Grund allen Seins. Christen, und besonders die Theologen unter ihnen, haben daher allen Grund, den Glauben an diesen Gott selbstbewusst zu verkünden.
Nicht überheblich. Aber freudig und mit der Zuversicht, dass der Gott, von dem das „Buch der Bücher“ kündet und der sich uns in Geschichte in der Person Christi vorgestellt hat, exakt derselbe ist, der auch das „Buch der Natur“ verfasst hat.
Auf dass Glaube und Vernunft, wie Papst Johannes Paul II. in „Fides et ratio“ schrieb, sich „wie die beiden Flügel“ ausnehmen, „mit denen sich der menschliche Geist zur Betrachtung der Wahrheit erhebt“.
Die Printausgabe der Tagespost vervollständigt aktuelle Nachrichten auf die-tagespost.de mit Hintergründen und Analysen.