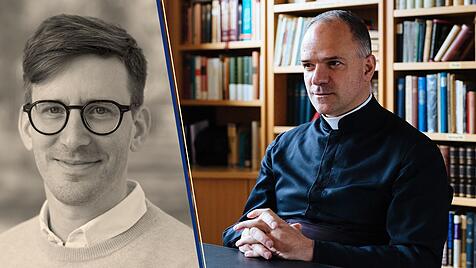Spätestens seit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts von 2020 steht fest: Die „Sterbehilfe“, eines der biopolitischen Dauerthemen unserer Epoche, muss neu geregelt werden. Dementsprechend fand nun auch eine erste Orientierungsdebatte im Parlament zur Gesetzesnovelle statt. Weitere Lesungen werden folgen. Und immer stellt sich erneut die Frage, wem der Tod gehört. Nur einem selbst oder hat das gesellschaftliche Umfeld ein Mitspracherecht? Die Pole liegen in der Diskussion weit auseinander.
Die einen fordern die „aktive Sterbehilfe“, weil sie sie als Teil des durch die Menschenwürde verbürgten Freiheitsgrundsatzes verstehen, die anderen betonen die Gefahr, dass eine Liberalisierung letztlich ökonomische Anreize zum assistierten Suizid setzen könnte. Während sich nicht wenige Ärzte in der Pflicht sehen, chronisch Schmerzkranken eine Möglichkeit zum autonomen Abschiedsnehmen von der Welt aufzuzeigen, insistieren andere Mediziner auf die Palliativmedizin. Glücklicherweise verspricht der Fortschritt vielen Menschen einen weitestgehend schmerzfreien Tod. Doch wollen sie nicht trotzdem lieber selbst über ihr Schicksal entscheiden? Eben die Wahl haben?
„Erst der einsame Tod schafft Ängste und drängt uns zu der Frage,
wie wir ihn so kurz und so schnell wie möglich herbeiführen“
Der vermeintlich unversöhnliche Streit veranschaulicht indessen auf der Metaebene, dass es längst keinen Konsens darüber gibt, was wir heute unter einem „guten“ Tod verstehen. Schließlich ist er auch aus der Öffentlichkeit verschwunden. Die permanente Übersteigerungsformel des spätmodernen Subjekts, Optimierungs- und Fitnesswahn, Körperkult und Leistungsprimat, überhaupt: die Doktrin, allseits funktionsfähig sein zu müssen – all diese Faktoren tragen dazu bei, dass das Ausscheiden aus dem Dasein vor allem als ein Störmoment gilt. Er muss beseitigt werden. Das neue Ziel lautet: das ewige Leben, worauf sich längst die Wissenschaft festgelegt hat. Nur mangelt es dem Bemühen um ein immer längeres Leben sichtlich an der der Diskussion über die qualitative Ausgestaltung desselben.
Damit der Tod nicht triumphiert, richtet sich das Handeln der Politik vor allem auf Abwehrmechanismen. So spricht etwa der der Kulturphilosoph Byung-Chul Han mit Hinblick auf seine Kritik an den Coronamaßnahmen etwa jüngst von der „immunologischen Gesellschaft“. „Der Schmerz ist der Tod im Kleinen – der Tod der Schmerz im Großen“, wusste schon sein Bruder im Geist, Martin Heidegger, zu sagen, der konsequent die humane Existenz vom Ende her dachte. Gewiss, das Bild vom unermesslichen Leiden bereitet natürlich Angst, gerade in einer Mediengesellschaft, die bei diskursiver Ausgrenzung des Todes zugleich permanent Aufnahmen von ihm – seien es die Leichen aus Bergamo oder die umgebrachten Zivilistinnen und Zivilisten in der Ukraine – verbreitet.
In früheren Zeiten war das Sterben Familienangelegenheit
Die Medien vermitteln den Tod – wohl auch der grauenvollen politischen Umstände geschuldet – insbesondere als angstbesetztes Thema. Sie entfremden ihn, offenbaren ihn und die Zeit vor ihm als Phasen der Einsamkeit und Agonie. Im Gegensatz dazu hielt der Philosoph Emanuel Levinas fest: „Der Sinn des Todes nimmt seinen Anfang zwischen den Menschen.“ Noch in früheren Zeiten, als man noch nicht an Altersheime dachte, wurde nicht selten im Kreis der Familie gestorben. Der Tod war unausweichlicher Teil des Lebens und noch kein, wie Thomas Macho es einmal mit Blick auf die individualistische Gesellschaft bezeichnete, „Projekt“. Er lud dazu ein, den Schmerz des Sterbenden Zuhören und Zureden mitzutragen. Man könnte sagen: Der Tod stellte Nähe her, weil er uns als verletzliche Wesen kennzeichnet.
Gewissermaßen einstudieren und beobachten lässt sich diese Gemeinschaftlichkeit im Theater. Schon die antiken Tragödien geben wichtige Hinweise dazu. Ihre ganze Traditionslinie und allen voran die sophokleischen Dramen über den Fluch der Labdakiden lässt sich als einzige Lehrstunde über das Sterben begreifen. Ihre Protagonisten, darunter Ödipus und Antigone, sind stets vom Schicksal dazu verurteilt, einen Prozess der Qualen zu durchlaufen. Zu ihrer heroischen Reifung gehört das Wachsen am inneren und äußeren Widerstand. Erst durch ihr Leiden können sie zu ethischer Größe gelangen und ihre bevorstehende ausweglose Katastrophe annehmen.
Der einsame Tod macht Ängste und beflügelt Wünsche
Indessen werden die Zuschauer zu Mit-Leidenden und bauen zumindest im fiktionalen Kosmos ein Verhältnis zum Tod auf. Er muss nicht trennen. Er sollte zusammenführen. Eine der schönsten Wendungen für dieses gegenseitige Finden ist im Spätwerk der 1996 verstorbenen Autorin Marguerite Duras dokumentiert. Nachdem sie in ihrer Literatur ihren weitaus jüngeren Gefährten Yann Andréa stets siezte, bezeugt ein kurzer Dialog aus den letzten Tagen den schwindenden Abstand zwischen ihnen: „Kommen Sie, ich nehme Sie mit. / Sagen Sie es anders. / Komm. Ich nehme dich mit.“ Aus Sie wird Du. Und aus der beklemmenden Wirklichkeit des kommenden Abschieds wird zuletzt ein beinah hoffnungsvoller Konjunktiv – er kann am Ende jeder Leidensgeschichte stehen, in der man alle Schwere abgeworfen hat. „Hier, in diesem erfundenen Himmel wären wir. / Nirgendwo“, schreibt Duras noch – oder anders gesagt: an einem Ort, der keinen Namen kennt.
Der Tod scheint für sie offensichtlich noch so Manches, möglicherweise Tröstliches bereitzuhalten. Nur was können uns derlei Ein- und Ansichten für die aktuelle Diskussion mitgeben? Sie geben bestimmt keine eindeutigen Antworten, lesen sich aber als eine Einladung dazu, weniger verkrampft über das Sterben zu sprechen oder es gar in eine Schwarzweiß-Logik zu packen. Durch sie geht potenziell ein wenig Schrecken verloren, was es für vielen von schlimmsten Schmerzen Betroffenen leichter machen dürfte, sich über den letzten Weg etwas beruhigter mit dem engsten Freundes- und Familienkreis zu verständigen. Denn erst der einsame Tod schafft Ängste und drängt uns zu der Frage, wie wir ihn so kurz und so schnell wie möglich herbeiführen. Sich ihm zu stellen, samt der Überlegungen zu einem assistierten oder nicht-assistierten Abschied, bedeutet in jedem Fall, aus den Projektionen auf den Tod herauszutreten.
Mit Rilke das Hier und Heute klarer betrachten
Rainer Maria Rilke, der in vielen Gedichten die altägyptische Nähe zwischen Menschen und Göttern als Ideal für einen gleitenden Übergang von der physischen in die metaphysische Sphäre feierte, bekennt daher in dem Poem „Todes-Erfahrung“: „Wir wissen nichts von diesem Hingehn, das / nicht mit uns teilt […] / Doch als du gingst, da brach in diese Bühne / Streifen Wirklichkeit durch jenen Spalt / durch den du hingingst: Grün wirklicher Grüne, / wirklicher Sonnenschein, wirklicher Wald.“ Den Tod zu verklären, wäre falsch, insbesondere in der aktuellen Diskussion, die aus so unermesslichen Leiden zahlreicher Menschen resultiert. Doch das war keineswegs Anspruch des Jahrhundertwende-Autors. Was er hingegen treffend einfängt, ist der Zugewinn an Erkenntnis, den jede Beschäftigung mit dem dunkelsten Kapitel unser aller Existenz mit sich bringt. Die letzte Reise mündet aus diesem Standpunkt heraus nie in der Finsternis, sie lässt uns das Hier und Heute eher noch klarer und umfassender betrachten.
Vom Autor sind in diesem Jahr erschienen: „Verschwörung einer Landschaft“. Gedichte. Quintus; „Verzeichnis der verschwindenden Pfade“. Gedichte. Limbus. Beide jeweils 15 EUR.
Die Printausgabe der Tagespost vervollständigt aktuelle Nachrichten auf die-tagespost.de mit Hintergründen und Analysen.