Britischen Kindern in den ersten Jahren des 19. Jahrhunderts, die ihren Pudding nicht aßen, wurde wirksam gedroht: Noch einen Löffel oder Boney kommt und holt dich! Dieses Schreckgespenst, das seine Wirkung nicht verfehlte, war der Kaiser der Franzosen. Der am 5. Mai 1821 sehr fern der Heimat gestorbene Napoleon ist immer noch recht lebendig, wird - je nach Einstellung - als Erfinder des modernen Staates glorifiziert oder als Zerstörer einer gottgewollten Ordnung verwünscht. Einigkeit herrscht, dass der große Korse mehr war als nur ein Kriegsheld, der auf den Flügeln der Revolution den Kontinent umpflügte. Der britische Historiker Andrew Roberts - die Briten waren am Ende die erbittertsten Feinde Napoleons, weit mehr als Deutsche oder Russen - gibt zu bedenken, dass viele Ideen, die unserer heutigen Welt zu Grunde liegen, wie Leistungsgesellschaft, Gleichheit vor dem Gesetz, verbrieftes Recht auf Eigentum, säkulare Erziehung und Gleichheit der Religionen, geordnete Staatsfinanzen, effiziente und rationale Verwaltung, von dem als Feldherrn angetretenen Franzosen stammen, der zudem noch das größte Gesetzeswerk seit dem römischen Recht zustande brachte.
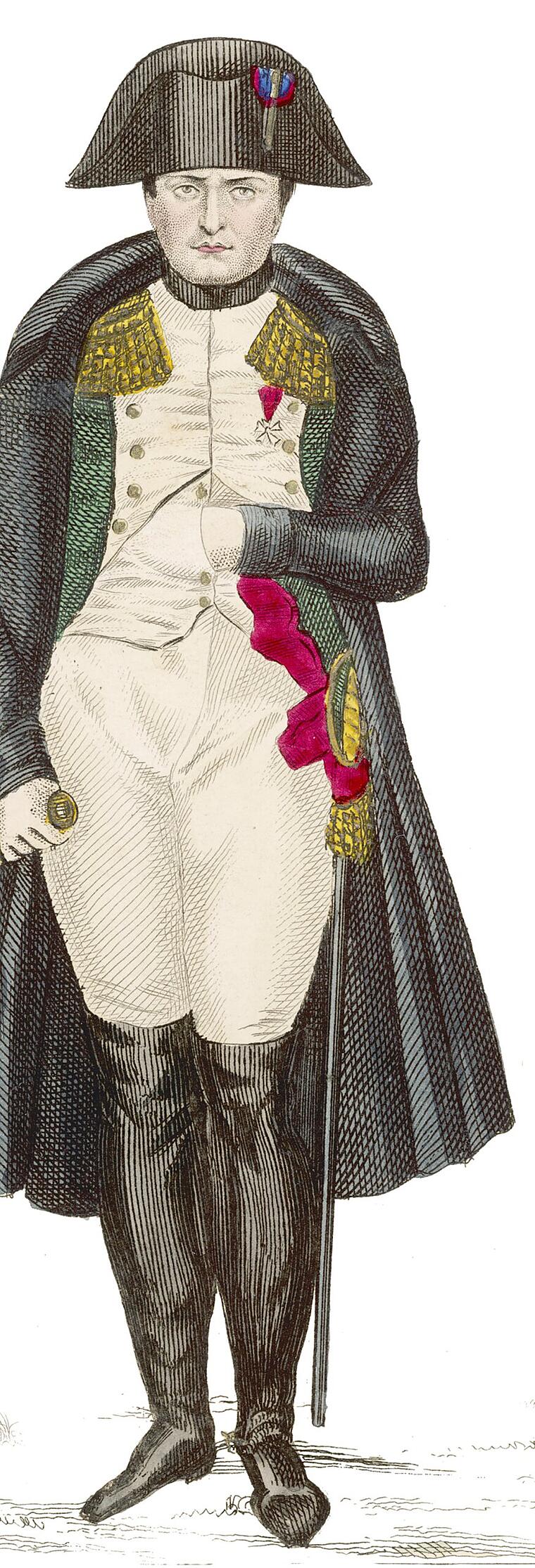
In der Geschichtsschreibung gibt es mehrere Ansätze, des Phänomens Bonaparte Herr zu werden. Wenig originell, aber sinnvoll erscheint es, den Aufstieg im Sinne der Entfaltung eines Mythos zu deuten, dem logischerweise der Niedergang - aber wann begann er? - folgte, samt den hundert Tagen von 1815. Doch braucht es noch ein Nachtragskapitel: Napoleon war einer der ersten Staatenlenker, der sein eigenes Bild in der Öffentlichkeit sorgsam modulierte. Im Exil auf jener britischen Insel im Südatlantik schuf er mit dem Mémorial de St. Hélène, den Memoiren, die er dem Getreuen Emmanuel de Las Casas diktierte, die Grundlage für einen bis heute anhaltenden Kult.
Nicht nur inszenierte er sich als Opfer der Unfähigkeit seiner Umgebung, vor allem brachte er sich als Proponent des europäischen Völkerfrühlings in Erinnerung, als der, der diversen Ländern Hebammendienste bei der Nationwerdung leistete, uneigennützig natürlich. Diese Sicht der Dinge feiert bis heute fröhlich Urständ, hat in jenem Propagandatext, wie der Historiker Jean Tulard schreibt, sein Brevier des Bonapartismus gefunden. Erst seit kurzem liegt die Urfassung des Mémorials vor, das der Gouverneur von St. Helena seinerzeit dem abreisenden Las Casas abgenommen hatte. Der Blick, mit dem der Ex-Kaiser auf sein Wirken schaute, wirft die Frage nach seiner Prägung in der Jugend auf.
Der Mann, der sein Leben auf einer Insel aushauchen sollte, war von einer solchen, aus Korsika, das man das Gebirge des Mittelmeers nennt. Die noch halb-feudale Gesellschaft der Insel, die Loyalität zum Clan, dem man lebenslang verpflichtet ist, auch ein brigantenhafter Übermut, der gelegentlich alles auf eine Karte setzt, paart sich beim jungen Artillerieoffizier (damals die modernste Waffengattung) mit der Fähigkeit zum Berechnen von Situationen, dem Wissen, wann der alles entscheidende Schlag sinnvoll oder sinnlos sein kann. Zu Beginn der Revolution war Napoleon weder ein großer Freund der Bourbonen - die immer ein schwieriges Verhältnis zu Korsika hatten -, noch ihr erbitterter Feind, hatte man ihn doch zur Offiziersschule zugelassen. Dort beschrieb man den jungen Eleven mit dem seltsamen Akzent als eher verschlossen und vor allem als manischen Leser, der möglichst viel Wissen in sich aufzunehmen suchte.
Abscheu vor ungezügeltem Volkswillen
Zu jeder großen Karriere gehört Glück, und das war Napoleon lange hold. Er machte sich in der noch instabilen jungen Republik die richtigen Menschen zum Freund und achtete darauf, wenig Feinde zu haben. Aber er hatte eben auch einen Namen seit den italienischen Feldzügen, bei denen die Franzosen immer in der Unterzahl gewesen waren. Seine dort eingeübte Spezialität, genau geplante Kanonaden mit überfallartigen Kavallerieattacken zu paaren, ließ ihn zum Erfolgreichsten unter den vielen Generälen werden und spülte ihn nach oben.
Das brodelnde Paris war freilich ein Haifischbecken, hier bedurfte es zusätzlicher Qualitäten. In diesen wirren Jahren mit Sansculotten und Jakobinern, dem revolutionären Pathos in der Volksvertretung, aber auch den anfänglichen Massenhinrichtungen bildete sich beim kühl beobachtenden General eine Maxime, der er immer treu bleiben sollte und die die Grundlinie seines politischen Denkens bestimmte: Die Abscheu vor dem ungezügelten Volkswillen, der sich täglich ändern konnte, stets manipuliert wurde und daher gezähmt gehörte. Hier traf sich der offiziell zur revolutionären Partei gehörende General ungewollt mit den Vertretern der alten Ordnung. Zugleich bot ihm der abstoßende Terror, der die ersten Jahre der französischen Republik markierte, auch die Rechtfertigung für die gekonnte Manipulation der Vertretungskörperschaften, die er dann im zum Kaiserreich gewordenen Frankreich betrieb: Er musste sein Volk vor den Politikern bewahren.
Das Menschenbild Napoleons, das sich zu Beginn seiner Karriere formte, war ein durchweg pessimistisches. Er behalf sich mit der Figur der "souveraineté populaire". Diese Souveränität des Volkes meinte ganz sicher nicht eine repräsentative Demokratie im heutigen Sinne. Es liegt dem eher die Idee eines Bündnisses und einer Interessengemeinschaft zwischen dem Chef des Staates, der sich zuerst Erster Konsul, dann Kaiser nannte, und dem Volk zugrunde. In entscheidenden Momenten, bei der Einführung der wechselnden Verfassungen, auch bei der Frage der Erbmonarchie ließ Napoleon das Volk zu Wort kommen, im Wissen, dass es seinen Willen bestätigen würde. Danach hatte es wieder zu schweigen. Der Begriff Zivildiktatur für Napoleons Regierungssystem legt sich nahe.
Napoleon arbeitete bis zu 20 Stunden
Des Kaisers Haltung zur Demokratie ist zwiespältig. Auf die Staatsmaschinerie, die Art zu regieren bezogen sieht es anders aus. Das bourbonische Frankreich war auf den König konzentriert, der alle Macht in Händen hielt. Nur zur Erhebung neuer Abgaben gab es ein begrenztes Mitspracherecht, bei drei verschiedenen Steuersystemen. Auch wenn das Land seit jeher zentralistischer organisiert war als etwa das Heilige Römische Reich, sorgten doch mehrere Binnenzollgrenzen und die mangelnde Gleichheit bei Maßen und Gewichten für Reibungsverluste. Napoleon schuf in jeder Hinsicht Klarheit und Eindeutigkeit: Die Einteilung Frankreichs in Departements und Arrondissements, eine stringente Organisation des Gerichts-, aber auch des Steuerwesens, kurz Einheitlichkeit in allen Vollzügen. Das brachte den Modernisierungsschub, den das restliche Europa damals noch vor sich hatte.
Durch die Einrichtung der "Grandes écoles" schuf der Kaiser nicht nur exzellente Lehranstalten für das Militär und alle Arten der exakten Wissenschaften, Institute, die im Nachbarland bis heute wichtiger als die Universitäten sind. Es gelang ihm so vor allem, zur Schaffung einer neuen Elite beizutragen, die nun allein auf Verdienst, in diesem Fall auf guten Noten, basierte. Herkunft und familiäre Beziehungen zählten nicht mehr, allein die Leistung. Die so ins Leben gerufene Meritokratie, so kann man sagen, leitet und lenkt Frankreich bis heute. Nicht nur alle höheren Beamte entstammen ihr, auch viele Politiker, wie der aktuelle Präsident und drei weitere von acht Staatschefs der Fünften Republik. Die Herrschaft dieser Mandarine hat aber auch eine andere Seite: Man bleibt unter sich, Kinder von Einwanderer-Familien finden sich dort nur selten. Damals jedoch war die Einrichtung dieser Elite-Anstalten ein bewusster Bruch mit dem Patronage-System des Königreichs.
Die Innovationskraft des Korsen
Auf dem Feld des Politischen gibt es weitere Neuerungen, die sich der Innovationskraft des Korsen verdanken. Eng mit der Herrschaft der Spezialisten hängt zusammen der Vorrang der Exekutive. Napoleon misstraute nicht nur dem Volk, sondern auch der Volksvertretung. Er fürchtete stets, dass im Parteienhader die Interessen der Nation und insbesondere der Armee zu kurz kamen. Zwar konnte sich auch theoretisch der König des alten Regimes in jede Staatsangelegenheit einmischen, er tat es aber oft nur, um Günstlinge unterzubringen. Napoleon als Kaiser aber verstand sich als der oberste Beamte des Landes, der selber oft bei Details im Sinne eines Mikro-Managements nachhakte. Bis zu vier Sekretäre beschäftigte er gleichzeitig, ohne Unterlass diktierend, an Arbeitstagen, die bis zu 20 Stunden dauerten. Auch heute kann der französische Präsident mittels präsidialer Dekrete, die wie bei den Bourbonen "Ordonnances" heißen, zumindest für eine Zeitlang am Parlament vorbeiregieren. Die "Executive Orders", die dem amerikanischen Präsidenten eine ähnliche Macht gewähren und die Ex-Präsident Trump in extenso benutzte, sind eine direkte Übernahme aus dem französischen System. Das Revolutionsland USA lernte also vom revolutionären Frankreich.
In der Außenpolitik war Bonaparte Innovator, indem er das Nationalitäten-Prinzip erfand. So wie er nach innen Frankreich zusammenführte, auf eine einheitliche Schul-, Schrift- und Verwaltungssprache drängte und die gut ausgebildeten Staatsbeamten zum Kern einer neuen Aristokratie machte, so präsentierte er sich nach außen als Befreier der europäischen Völker, die er von dynastischen Erbfolgeregelungen reinigen und ihnen ihre natürlichen Grenzen geben wollte. Auf den Westen Deutschlands bezogen, sah er - Karl den Großen im Blick - die Grenze des neuen Franken-Reiches beim Rhein. In Italien und Deutschland, die je einen Flickenteppich aus kleinen Territorien darstellten, wirkte er dadurch staatsbildend. Ohne den desaströsen Russland-Feldzug hätte auch Polen die Segnungen dieser nationalen Ordnungspolitik erfahren. In Spanien allerdings scheiterte er völlig damit, denn der erwachende Nationalismus richtete sich gegen die Franzosen. Auch darf nicht vergessen werden, dass der hehren Idee eines Europas der Völker eine starke Prise französischer Machtpolitik beigemischt war. Frankreichs Vorrang in Europa stand nie zur Disposition, ebenso die Kolonien, die nicht aufgegeben wurden. Erbe des napoleonischen Ansatzes ist auch die mit dem Begriff Frankophonie belegte Förderung der französischsprachigen Gebiete in Afrika, Kanada und der Karibik. Unter dieser Marke verfolgt das Land Ordnungspolitik, wie Deutschland das nie könnte.
Eine große und bleibende Reform gelang in der Rechtspolitik. Mit dem 1804 eingeführten Code Civil, dem bürgerlichen Gesetzbuch, wurde nicht nur zum ersten Mal ein einheitliches Werk geschaffen, das die Vielzahl der bisherigen Rechtsquellen in sich aufnahm, es folgte zudem neuen, bisher nicht gekannten Grundsätzen: Gleichheit der Bürger vor dem Gesetz, zahlreiche Freiheitsrechte (etwa für die Juden), Garantie der Vertragsfreiheit und des Eigentums, aber auch das Ende jeglicher kirchlicher Eigenrechte. Der Gedanke, dass jeder Citoyen dem Anderen als freies Rechtssubjekt gegenüberstand, war etwas Neues. Die Kodifikation war stilbildend und wurde von vielen Staaten übernommen. Der 1810 erlassene Code P nal dagegen, das Strafgesetzbuch, diente mehr der Kontrolle des Volkes. Dazu traten Zivilprozessbuch, Handelsgesetzbuch und die Strafprozessordnung, die "Cinq Codes", die durch ihre bloße Existenz andere Staaten anspornten, Ähnliches auf den Weg zu bringen. Durch diese gesetzgebende Tätigkeit brachte Napoleon das französische Rechtsdenken auf die Landkarte, wo es heute für 300 Millionen Menschen den Ordnungsrahmen bildet.
Künstler begeisterte er erst, dann stieß er sie ab
Von den schönen Künsten interessierte den Soldaten die Musik am meisten, als Mensch des Mittelmeeres hatte er ein Verhältnis zur Oper. Doch in allen Bereichen der Kunst, Literatur, Malerei, Skulptur, Architektur wirkte Napoleon inspirierend, zwang die Künstler zur Stellungnahme. Beethoven widmete ihm zunächst eine Symphonie, die Eroica , und strich seinen Namen später enttäuscht aus der Widmung. Dafür schrieb er 1813 ein anti-französisches Tongemälde Wellingtons Sieg - so wie Tschaikowsky siebzig Jahre später den russischen Sieg über den Eindringling in der Monster-Ouvertüre 1812 feierte, Glockenklang und Kanonendonner inbegriffen. Der Aufbruch, der mit dem jungen Napoleon kam, brachte den Stil des Empire hervor, als Wiederbelebung des Griechisch-Römischen, was für einige Jahre sogar die Kleidung beeinflusste. Viele Künstler hat Napoleon zunächst begeistert, als Kaiser dann abgestoßen. Für Heinrich Heine aber blieb er ein weltlicher Heiland , für ihn war der einstige Nationalfeind der Befreiungskriege vor allem ein Held des Liberalismus. Jedes Land arbeitete sich an ihm ab, baute ihn als Helden oder Schurken in die eigene Geschichte ein.
Im Resümee: Bonaparte war ein Erneuerer auf allen Gebieten in Krieg und Frieden. Vieles von dem, was er einführte, ist immer noch da, wie Meter-Maß und Hausnummern. Er ist uns also unentbehrlich, und sei es als Fabel von Aufstieg und Fall des Großen Mannes. Der erfolgreiche Jockey der Sattelzeit war aber doch ein Sterblicher, der, als seine Reflexe schwächer wurden, Opfer des eigenen Wahns wurde: Russland zu erobern ist noch niemandem gelungen. Danach ging es bergab.
War er eigentlich ein Christ?
War er eigentlich ein Christ? Die Antwort fällt nicht leicht. Man muss den felsenfesten, die Familie prägenden Glauben der Mutter Laetitia in Rechnung stellen, die Beeinflussung durch den Deismus in den ersten Pariser Jahren. Sobald er es konnte, half Napoleon, den anti-christlichen Terror der Jakobiner zu stoppen. Das Konkordat von 1801 stand in gallikanisch-nationalkirchlicher Tradition: Der Zuschnitt der Bistümer richtete sich nach den Departements, Bischöfe brauchten eine staatliche Erlaubnis. Ihr Vermögen bekam die Kirche nicht zurück, doch war der Frieden wiederhergestellt. In der Hoffnung auf weitere Zugeständnisse war Papst Pius VII. 1804 zur Kaiserkrönung gekommen, wurde aber letztlich zum Statisten degradiert.
Doch hielt es der zum Kaiser Gewordene dann für seine Pflicht, jeden Morgen der Messe beizuwohnen. Im Exil in St. Helena hielt er fest: "Meine Herren, ich kenne die Menschen. Jesus Christus war mehr als ein Mensch. (...) Zwischen dem Christenglauben und welcher Religion auch immer liegt die Kluft der Unendlichkeit". Sein Ende ist jedenfalls das eines Katholiken, aus Korsika muss eigens ein Priester über den Atlantik kommen, um ihn zu versehen. Er starb vor zweihundert Jahren, um als Mythos weiterzuleben. Napoleon hat zugleich zerstört und aufgebaut. Die Revolution hat er in Wahrheit abgebrochen. Einem linken Abgeordneten im Frankreich dieser Tage war das nur zu bewusst, als er auf die Frage, wie das Todestags-Jubiläum zu begehen sei, meinte: "Die Republik muss ihren Grabschaufler nicht feiern." Der sozialistische Bürgermeister von Rouen will an diesem Tag sogar die Statue des Kaisers vor dem Rathaus abbauen. Der Revolutionär, der zum Anti-Revolutionär wurde ist das eine; das andere das Beispiel, das er Europa und der Welt gegeben hat, indem er den Volkszorn in ein Projekt des Staatsaufbaus münden ließ. Wir alle dürfen Napoleon als guten Diktator wenn schon nicht feiern, dann doch gelten lassen.
Die Printausgabe der Tagespost vervollständigt aktuelle Nachrichten auf die-tagespost.de mit Hintergründen und Analysen.













