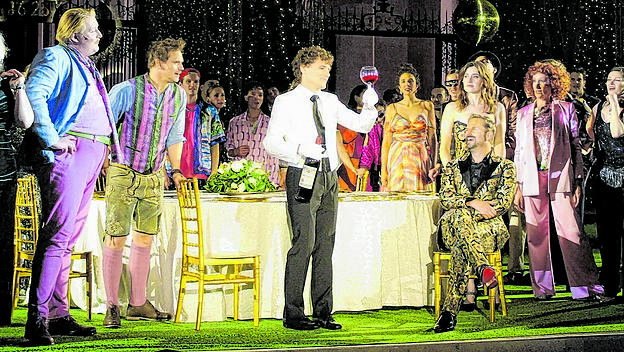Pater Blankenhorn, Sie haben gerade ein dreitägiges Sommerseminar zum Thema „Debatten über die menschliche Freiheit im 13. Jahrhundert“ abgehalten. Veranstalter war – in Zusammenarbeit mit dem „Thomistic Institute“ in Washington und der Päpstlichen Universität Heiliger Thomas von Aquin (Angelicum) in Rom – das „Institut für Dominikanische Studien“. Was steckt hinter diesem Institut?
Das ist ein neues Institut, das vor zwei Jahren innerhalb der Theologischen Fakultät der Universität Fribourg in der Schweiz gegründet worden ist. Das Ziel ist es, das Erbe der Dominikaner in den verschiedenen Disziplinen zu pflegen und wieder aktuell zu machen. Wir wollen dominikanische Philosophie, Theologie, Geschichte, Spiritualität und Bibelexegese in der dominikanischen Tradition sowohl historisch als auch systematisch studieren. Dazu nutzen wir unterschiedliche Formate: Wir veranstalten unter anderem wissenschaftliche Kolloquien sowie Sommer- und Winterseminare. So ein Seminar wie jetzt über die Freiheit haben wir zum ersten Mal veranstaltet. Es war der Versuch, jungen Forschern – Masterstudenten, Doktoranden, aber auch junge Professoren – auf hohem Niveau einen tieferen Einstieg in die dominikanische Tradition zu ermöglichen.
In den USA gibt es das „Thomistic Institute“, das inzwischen weltweit präsent ist und ähnliche Ziele verfolgt wie Ihr Institut. Gibt es eine internationale Renaissance des dominikanischen Denkens?
Ja, das ist so. Es gibt in Italien, Frankreich, England, Nordamerika und anderen Ländern, zum Teil auch in Afrika und in Asien, eine große Zahl junger dominikanischer Gelehrter, die sich intensiv mit der philosophischen und theologischen Tradition des Ordens, insbesondere der Scholastik, beschäftigen. Ich selbst war zwei Jahre lang stellvertretender Direktor des „Thomistic Institute“ am Angelicum in Rom. Am „Institut für Dominikanische Studien“ läuft vieles über Kooperationen. Zum Beispiel organisiere ich fürs kommende Jahr ein Kolloquium über einen großen Schweizer Theologen aus dem 20. Jahrhundert, der sich sehr um die dominikanische Theologie verdient gemacht hat: Kardinal Charles Journet. Das Angelicum wird Mitveranstalter sein. Es gibt ein informelles Netzwerk, in dem es oft ähnliche Projektinteressen gibt und wir bei Gelegenheit gemeinsame Veranstaltungen organisieren. Auf diese Weise sind wir alle Teil der Erneuerung der Philosophie und Theologie.
Innerhalb der deutschen Theologie scheint man mit der dominikanischen Tradition und mit der Scholastik insgesamt eher zu fremdeln. Wie ist das Verhältnis zur deutschen Theologie?
Unsere Bewegung kommt hauptsächlich von Institutionen, die außerhalb des staatlichen Universitätssystems existieren, ob es nun private Hochschulen sind oder ein Studienhaus einer Ordensprovinz wie das in Toulouse. Wir pflegen aber keinen Traditionalismus, bei dem wir versuchen, das 13. Jahrhundert wiederherzustellen. Bei vielen unserer Projekte arbeiten wir mit Forschern zusammen, die ganz andere Interessen, Grundüberzeugungen und Methoden haben als wir. Wir diskutieren auch schon über Wege, wie wir deutsche philosophische Traditionen – zum Beispiel den Kantianismus – mit einer dominikanischen Tradition wie zum Beispiel dem Thomismus ins Gespräch bringen können. Allerdings ist es so: Wenn Leute außerhalb des Dominikanerordens bestimmte Elemente, Themen und Schriften der dominikanischen Tradition überhaupt nicht kennen, dann gibt es gar keine Möglichkeit für einen Dialog.
Wie groß war die Nachfrage nach Ihrem Sommerseminar zur menschlichen Freiheit und woher kamen die Teilnehmer?
Wir hatten ungefähr 50 Bewerbungen und haben 20 Teilnehmer ausgewählt. Darunter waren zwei Professorinnen und ein paar Magisterstudenten, die allermeisten aber waren Doktoranden. Die Leute kamen aus Deutschland, Österreich, Slowenien, Kroatien, Rumänien, Polen, Argentinien, den USA, Ostasien und Nigeria. Seminarsprache war Englisch. Aber wir haben die Messe im Novus Ordo auf Latein gefeiert, auch um diese Internationalität zu respektieren und zu zeigen, dass Englisch nicht immer die wichtigste Sprache ist.
Warum haben Sie das Thema menschliche Freiheit gewählt?
Es gibt in der Philosophie wie auch in der Theologie Randfragen, die in sich selber interessant sein können, aber die am Ende nicht die wichtigsten sind. Und dann gibt es bestimmte Themen, die eine Art Kreuzung darstellen, wo viele andere wichtige Fragen immer mit im Spiel sind. Das sind Themen, die für einen synthetischen Blick auf die Realität zentral sind, so zum Beispiel das Verhältnis von Natur und Gnade. Wenn ich den Zusammenhang zwischen Natur und Gnade missverstehe, dann geht alles andere schief. Auch lässt sich zum Beispiel ein Großteil der Theologie im 20. Jahrhundert in verschiedene Gruppen, Bewegungen und Kategorien einteilen. Wenn man erklären kann, wo Karl Rahner, Hans Urs von Balthasar oder Karl Barth bei der Frage nach dem Verhältnis von Natur und Gnade stehen, dann hat man schon sehr viel verstanden. So ist es auch mit dem Thema Freiheit. Von den Griechen über die Kirchenväter bis hin zu den muslimischen Philosophen in Spanien haben sich alle damit beschäftigt. Im Rahmen des christlichen Denkens gibt es die besondere Frage nach der Freiheit der Christen in Christus. Mit Augustinus kommt dann im Zuge der Debatte um den Manichäismus auch das Problem des Determinismus auf. Später im Mittelalter wird die Frage diskutiert, ob die Planeten oder die Sterne schon alles für uns im Voraus entschieden haben. Man kann das sogar mit dem heutigen biologischen Determinismus vergleichen. Es gibt ja viele in den Naturwissenschaften, die gar nicht an die menschliche Freiheit glauben. Zugleich bringt die Freiheitsfrage viele Disziplinen und Unterdisziplinen zusammen. Man braucht dafür ein Verständnis von Metaphysik, eine Anthropologie mit Blick auf das Verhältnis von Seele und Körper und auch eine Erkenntnistheorie.
Wie kam es zur Auswahl der drei historischen Gewährsmänner Ihres Seminars sowie zur Auswahl der Dozenten?
Wir wollten eine Art Trialog zwischen Thomas von Aquin, Heinrich von Gent – einem belgischen Weltpriester und Theologen, der am Ende des 13. Jahrhunderts lange in Paris doziert hat und sehr einflussreich war – sowie Johannes Duns Scotus zustande bringen. Einer der Dozenten war Tobias Hoffmann, Professor für mittelalterliche Philosophie an der Sorbonne in Paris. Er kennt sich in diesem Thema und mit diesen Autoren exzellent aus. Und unser zweiter Seminarleiter war Albert von Thurn und Taxis. Er hat genau über dieses Thema im Kontext der Philosophie und Theologie des 13. Jahrhunderts am Angelicum in Rom promoviert, wo er auch unterrichtet. Die beiden waren ein ideales Team, weil sie sich sehr gut auskennen und in ihren Kompetenzen ergänzen. Ich selbst habe eine theologische Perspektive beigetragen, vor allem mit Blick auf das Verhältnis von Gnade und menschlichem Willen bei Thomas von Aquin und Duns Scotus.
Was wären die entscheidenden Unterschiede zwischen diesen drei Denkern – Thomas, Heinrich von Gent und Duns Scotus –, wenn es um die Freiheit geht?
In der ganzen zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts wurde die Frage debattiert, welchen Spielraum die klare Erkenntnis einer Situation für meinen freien Willen lässt. Kann er einer wahren Erkenntnis widerstehen? Wie sehr kann mein Wissen meinen Willen determinieren oder seine Fähigkeit, verschiedene Wege zu wählen, begrenzen? Es gibt dabei ein Spektrum an Antworten zwischen Intellektualismus und Voluntarismus, also der Betonung des Intellekts oder des Willens. Hinzu kommt die Frage, inwiefern Gottes Gnade innerhalb des Menschen auf seinen Willen wirken kann. Die Position des Thomas entwickelt sich im Laufe der Zeit. Er rückt von einem recht deutlichen Intellektualismus ab, um ein bestimmtes Gleichgewicht zwischen Intellekt und Willen zu finden, aber er bleibt immer noch näher beim Intellektualismus als beim Voluntarismus. Heinrich von Gent und Duns Scotus neigen viel stärker in Richtung Voluntarismus. Sie sehen in der Freiheit des Willens eine selbstbewegende Kraft, die den Menschen autonom macht. Hier sieht man deutlich einen möglichen Anknüpfungspunkt für das moderne Autonomiedenken, wie es sich insbesondere bei Immanuel Kant findet.

Die Printausgabe der Tagespost vervollständigt aktuelle Nachrichten auf die-tagespost.de mit Hintergründen und Analysen.