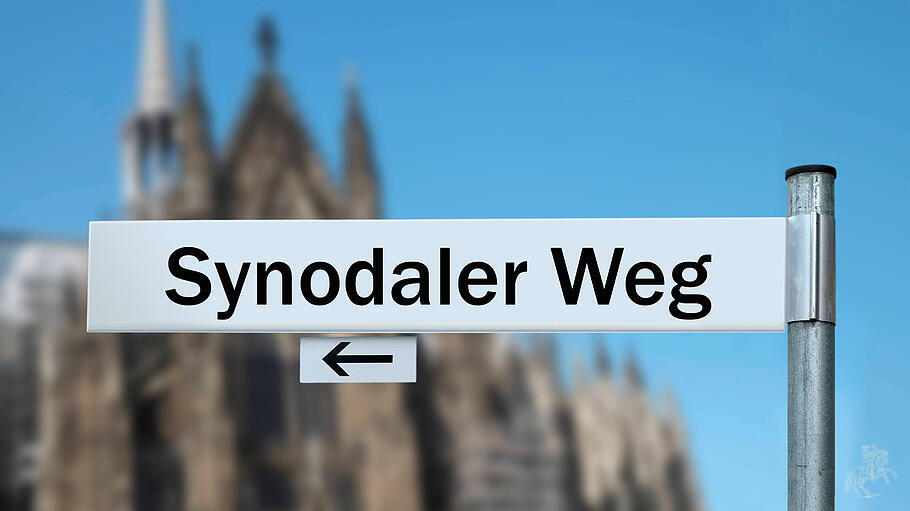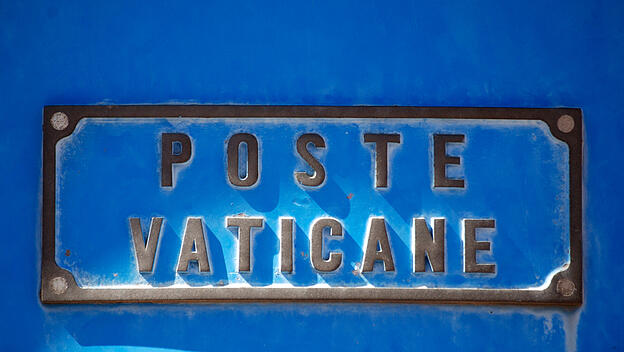Die Mitglieder des Synodalen Ausschusses treffen sich am Freitag und Samstag zu ihrer nächsten Sitzung in Fulda. Dann wollen sie abschließend über die Satzung des Synodalen Rates entscheiden. Alle Vorhaben, die der Synodale Weg von Anfang an verfolgt hat, scheinen nun klare Formen anzunehmen. Der von Rom verbotene Synodale Rat ist bald als „Synodalgremium auf nationaler Ebene“ Realität. Doch welche römischen Weisungen haben die Synodalen bisher umgesetzt? Ein Rückblick auf Ignoranz, Dialogversuche und Konflikte.
Seit 2023 lädt der Vatikan eine deutsche Delegation regelmäßig zu Gesprächen nach Rom ein. Grund waren mehrere Forderungen des Synodalen Weges und das geplante Synodalgremium auf nationaler Ebene, denen Rom mehrfach einen Riegel vorgeschoben hat. Die synodaldeutschen Rädchen liefen jedoch unbeirrt weiter, während man nach Rom signalisierte, sich innerhalb des Zweiten Vatikanischen Konzils und der Lehre der Kirche zu bewegen.
Kampfplatz gegen die Lehre der Kirche
Hauptstreitpunkt nicht nur innerhalb der katholischen Kirche in Deutschland, sondern auch zwischen Rom und den Drahtziehern des Synodalen Wegs war von Anfang an neben dem Kirchenverständnis die Sexualmoral und damit auch die christliche Anthropologie, die in Deutschland durch eine an der Gendertheorie orientierte Anthropologie ersetzt werden sollte.
Der Synodale Weg, der aufgrund der entsetzlichen Missbrauchsfälle in der katholischen Kirche initiiert worden ist, entpuppte sich schnell als Kampfplatz gegen die Lehre der Kirche selbst. Als „systemische Ursachen“ des Missbrauchs wurden der Zölibat, die Unmöglichkeit der Frauenweihe, die Sexualmoral und fehlende Entscheidungskompetenzen von Laien auch in Lehrfragen ausgemacht. Alle Debatten zu den Themen drehten sich um die Frage der Machtordnung.
Papst: „Gebet, Buße und Anbetung“ statt Strukturfragen
Daran geändert hat sich seit Beginn des Synodalen Wegs nichts, obwohl Papst Franziskus bereits im Juni 2019, noch bevor der Synodale Weg offiziell begonnen hatte, einen wegweisenden Brief nach Deutschland schickte: den „Brief an das Pilgernde Volk in Deutschland“. Darin mahnte er zu „Gebet, Buße und Anbetung“, schärfte den Deutschen ein, die Einheit mit der Weltkirche zu wahren und Neuevangelisierung als Hauptaspekt in den Prozess mit aufzunehmen; all das fehlte im Programm, der Satzung für den bald beginnenden Synodalen Weg; Frauenämter, Sexualmoral oder Zölibat blieben im Fokus und sollten es auch bleiben.
Um den Bitten des Papstes Rechnung zu tragen, haben der Kölner Kardinal Rainer Maria Woelki und der Regensburger Bischof Rudolf Voderholzer — zwei von wenigen anderen Bischöfen, die den synodalen Strategen regelmäßig widersprachen — zwar eine alternative Satzung ausarbeitet und vorgestellt, die wurde jedoch kurzerhand abgelehnt; die Mehrheit der Bischöfe und Funktionärskatholiken des Zentralkomitees der deutschen Katholiken (ZdK) sowie des BDKJ beharrten auf jenem Schwerpunkt, vor dem Papst Franziskus in seinem Brief gewarnt hat: auf Strukturfragen.
Stellungnahme mit Kritik aus Rom
In einer Stellungnahme vom 4. September 2019 wies die Kongregation für die Bischöfe und des Päpstliches Rates für Gesetzestexte darauf hin, dass die auf dem Synodalen Weg vorgesehenen Themen nicht allein die Kirche in Deutschland beträfen, sondern die Weltkirche, weshalb sie „…mit wenigen Ausnahmen – nicht Gegenstand von Beschlüssen und Entscheidungen einer Teilkirche sein“ könnten, „ohne gegen die Einschätzung des Heiligen Vaters zu verstoßen“. Auch die kirchenrechtliche Unmöglichkeit einer „Parität von Bischöfen und Laien“ wurde kritisiert: Die von Papst Franziskus gewünschte Synodalität in der Kirche sei kein Synonym für Demokratie oder Mehrheitsentscheidungen.
Auf diesen Einwurf aus dem Vatikan reagierte der Münchener Kardinal Reinhard Marx als damaliger Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz (DBK) in den Medien mit der Ankündigung, den vom Vatikan als „ekklesiologisch ungültig“ bezeichneten „verbindlichen Synodalen Prozess“ fortzusetzen. Seiner Ansicht nach könne der deutsche Weg Vorbild für die Universalkirche werden. Gegenüber Rom kommunizierten DBK und Zentralkomitee der deutschen Katholiken (ZdK) als paritätischer Mitorganisator des Reformprozesses, dagegen: Man wolle den gesamten Weg vom ‚Primat der Evangelisierung‘ her angehen und diesen als ‚geistlichen Prozess‘ gestalten.
Die Deutschen sehen sich bestärkt
De facto blieben Strukturfragen im Fokus. Die von Franziskus geforderte Neuevangelisierung sah man bereits durch dadurch abgedeckt, dass man sich mit den oben genannten Fragen beschäftigte. Eine Mahnung oder gar ein Verbot las man aus diesem Schreiben genauso wenig heraus wie zuvor aus dem Brief des Papstes, sondern sah sich bestärkt in der deutschen Initiative — wie immer, wenn aus Rom Bedenken und Forderungen zu einem Kurswechsel formuliert wurden. Am Ende wurde weder Evangelisierung behandelt, noch die Gender-Ideologie hinterfragt, so dass der Vatikan nach und nach auf alle der Kirchenlehre entgegenstehenden synodalen Forderungen reagierte.
Im Frühjahr 2021 erklärte die vatikanische Kongregation für die Glaubenslehre mit Unterstützung des Papstes offiziell, dass die Kirche keine Vollmacht habe, Verbindungen von Personen gleichen Geschlechts zu segnen, die eine sexuelle Praxis außerhalb der Ehe einschließen. Darauf reagierte der neue Vorsitzende der deutschen Bischöfe, der Limburger Bischof Georg Bätzing, besänftigend: „Die von der Glaubenskongregation heute vorgebrachten Gesichtspunkte müssen und werden selbstverständlich“ in die Gespräche des Synodalen Wegs integriert finden. Faktisch unterstützte der Synodalen Weg die Aktion „Out in Church“ mit 110 Gottesdiensten bundesweit die Segnung von homosexuellen Paaren und tat damit das Gegenteil von dem, was der Papst über die Kongregation angeordnet hatte.
Die Farce der „freiwilligen Selbstverpflichtung“
Innerhalb der Synodalversammlung gerieten die Bischöfe zunehmend unter Druck. Die Forderung nach der „freiwilligen Selbstverpflichtung“ der Bischöfe in Bezug auf die Umsetzung von Beschlüssen wurde immer lauter und das Wörtchen „freiwillig“ zu einer Farce, sagte doch Thomas Sternberg, damals noch Vorsitzender des Synodalpräsidiums und Präsident des ZdK, in einem Interview: „Wenn dann ein Bischof in einem kleinen Bistum eine Regelung nicht umsetzt, dann gibt es schon einen erheblichen Druck, und das wird auch nicht ganz ohne Folgen bleiben.“
Die Dogmatikerin Julia Knop, einer der führenden Köpfe des Synodalen Weges, sprach von „ewige Wahrheiten“ als Fiktion und forderte eine Weiterentwicklung der Kirche — was im Orientierungstext, der Präambel des Synodalen Weges, in der Formulierung der Berücksichtigung und Anpassung an die Lebenswirklichkeiten der Menschen von heute Niederschlag fand.
Dort wurde auch der Glaubenssinn des Volkes, der nur mit Papst und dem Lehramt Gültigkeit hat, umfunktioniert zu einem Machtinstrument der gegenwärtigen Forderungen und Strömungen aus Kirche und Gesellschaft: Der Papst als letzte Entscheidungsinstanz wurde ausgeklammert. Im Dokument wurde nur ein Satzteil aus „Lumen Gentium“ zitiert — und damit aus dem Kontext herausgerissen —, in dem es heißt, dass die Gesamtheit der Gläubigen nicht irren könne.
„Es braucht keine zweite evangelische Kirche in Deutschland"
Nach mehreren brüderlichen Ermahnungen von Bischöfen aus der Weltkirche, die Bätzing alle vom Tisch wischte, folgte der nächste Korrekturversuch von Papst Franziskus. Bei einem Treffen mit europäischen Chefredakteuren im Juni 2022 sagte er bezugnehmend auf den geplanten Synodalen Ausschuss, der in einen Synodalen Rat münden und den deutschen Reformprozess auf Dauer stellen sollte: „Es gibt eine sehr gute evangelische Kirche in Deutschland. Wir brauchen nicht zwei von ihnen.“
In einer Erklärung präzisierte der Vatikan kurz darauf, der Synodale Weg sei nicht befugt, „die Bischöfe und die Gläubigen zur Annahme neuer Formen der Leitung und neuer Ausrichtungen der Lehre und der Moral zu verpflichten“. Auch warnte der Vatikan erneut vor einer Gefährdung der weltkirchlichen Einheit. Von Gehorsam dem Papst gegenüber wollte man jedoch nach wie vor nichts hören.
Der von Rom gewünschte Effekt einer Kurskorrektur trat nicht ein. Die Deutschen fühlten sich missverstanden, erklärten, keinen Sonderweg gehen zu wollen — und verharrte in ihrem Denken. Die Dogmatikerin Julia Knop sagte wörtlich: „Katholik*innen denken und leben und gestalten die Kirche vor Ort so, wie sie es für richtig halten. Sie leisten dabei keinen ‚Glaubensgehorsam’, sondern übernehmen Glaubensverantwortung.“
Ton aus Rom wird deutlich schärfer
Damit wuchs der Druck auf lehramtstreue Bischöfe noch weiter. Nachdem wider Erwarten der Grundtext zur neuen Sexualmoral bei der vierten Synodalversammlung im September gescheitert war, forderte das ZdK, den abgelehnten Text, der sowohl mit der christlichen Anthropologie als auch mit der katholischen Morallehre bricht, bei der bevorstehenden Vollversammlung der deutschen Bischöfe nachträglich zu akzeptieren.
Daraufhin wurde der Ton aus Rom deutlich schärfer, Weisungen folgten in kürzeren Intervallen aufeinander. Im November 2023 meldete der Vatikan beim Ad Limina-Besuch der deutschen Bischöfe in Rom in allen entscheidenden Lehr- und Verfassungsfragen grundsätzliche Bedenken an; und zwar in Bezug auf „Methode, Inhalte und Struktur des Synodalen Weges“, weshalb sogar vorgeschlagen wurde, den Synodalen Weg bis auf weiteres auszusetzen.
Die Kurienkardinäle Marc Ouellet (bis 2023 Bischofskongregation) und Luis Ladaria (bis 2023 Glaubenslehre) erklärten, es werde inhaltlich keine Zugeständnisse an den Synodalen Weg geben. Einige Themen seien schlichtweg „nicht verhandelbar“, stellten sie klar und forderten die Deutschen auf, die bisherigen Papiere inklusive der noch zur Endabstimmung anstehenden Texte des Synodalen Weges in die Spur einer lehramtstreuen Theologie und des Zweiten Vatikanums zurückzubringen.
Päpstliches Verbot „in forma specifica“
Nichts dergleichen geschah. Da es laut Bätzing keine klaren Ansagen in Bezug auf den geplanten Synodalen Rat gegeben habe, werde dieser weiterverfolgt. Zudem gab sein Bistum Limburg im Januar 2023 neue Leitlinien zur Sexualpädagogik heraus, mit denen nicht nur alle roten Linien der kirchlichen Lehre überfahren wurden, sondern auch die römische Weisung vom Juli 2022.
Fast zeitgleich verbot Papst Franziskus in einem „in forma specifica“ (Januar 2023) formulierten und damit rechtswirksamen Schreiben an die deutschen Bischöfe die Gründung eines Synodalen Rates: „Weder der Synodale Weg noch ein von ihm eingesetztes Organ noch eine Bischofskonferenz“ hätten die Kompetenz, „den ,Synodalen Rat‘ auf nationaler, diözesaner oder pfarrlicher Ebene einzurichten“.
Das Verbot wurde ignoriert. Bätzing fand diese Bedenken „nicht begründet“, der Rat werde sich „innerhalb des gültigen Kirchenrechts bewegen“. Nuntius Nikola Eterovic mahnte kurz darauf bei der Frühjahrs-Vollversammlung im Februar 2023 erneut die Sorge um die Einheit der katholischen Kirche an. Ebenso erfolglos. Im November beschloss das ZdK die Satzung des verbotenen Synodalen Ausschusses.
Anwort an Vatikan: Praxis in Deutschland ist längst weiter
Ende März 2023 erklärte Kardinal Arthur Roche vom Gottesdienstdikasterium Bischof Bätzing in einem Brief, dass sowohl die regelmäßige Laienpredigt in der Messe als auch eine Taufe durch Laien regulär nicht möglich sei. Es antwortete die ZdK-Sprecherin Britta Baas. Man sei erfreut über diesen Brief aus Rom. Der zeuge nämlich von einem Interesse Roms an den deutschen Reformwegen.
Die Praxis in Deutschland sei schon längst weiter. Sowohl Laien-Predigten als auch Taufen durch Laien seien längst etabliert. Zugleich versicherte man weiterhin am laufenden Band, sich im Rahmen des geltenden kirchlichen Rechts bewegen zu wollen und großes Interesse am Dialog mit Rom zu haben, da man ja Missverständnisse ausräumen müsse.
Papst korrigiert deutsche Interpretation seines Briefes
Missverstanden fühlte sich aber auch Papst Franziskus. 2024 korrigierte er die Interpretation seines Briefes durch die Deutschen: „Die Kirche in Deutschland hat einen synodalen Weg eingeschlagen, zu dem ich 2019 einen Brief geschrieben habe, von dem ich wünschte, dass er stärker wahrgenommen, bedacht und umgesetzt würde, da er zwei Aspekte zum Ausdruck bringt, die ich für grundlegend halte, um nicht auf Abwege zu geraten. Da ist vor allem die Pflege der geistlichen Dimension, also die konkrete und beständige Angleichung an das Evangelium und nicht an die Leitbilder der Welt, indem man die persönliche und gemeinschaftliche Umkehr durch die Sakramente und das Gebet wiederentdeckt, die Fügsamkeit gegenüber dem Heiligen Geist und nicht gegenüber dem Zeitgeist. Und sodann die universale Dimension, die katholische Dimension, damit man das Glaubensleben nicht als etwas begreift, das sich bloß auf den eigenen kulturellen und nationalen Bereich bezieht.“
Bätzing klagt Rom an
Ebenfalls 2024 bekräftigte Rom sein Verbot von 2023 mit der Erklärung, dass niemand das Recht habe, einen Synodalen Rat in Deutschland als neues Entscheidungsgremium zu installieren und bat die Bischöfe im Februar, den Beschluss über die Satzung des Synodalen Ausschusses von der Tagesordnung der bischöflichen Vollversammlung zu nehmen. Unterschrieben hat den Brief unter anderem Kardinal Prevost, der heutige Papst Leo XIV.
DBK-Chef Bätzing kam der Bitte nach, reagierte aber auch mit einer Anklage: Hätte Rom gewollt, hätten Gespräche längst geführt und Missverständnisse ausgeräumt werden können. Vier Synodalinnen, die dem Papst ihre Sorgen in Bezug auf den deutsch-synodalen Kurs mitgeteilt hatten, habe er schließlich auch zügig geantwortet. Dass der Papst in jenem Brief den Synodalen Ausschuss verurteilte und die Sorge der vier Frauen „über die inzwischen zahlreichen konkreten Schritte“ teilte, mit denen sich große Teile der deutschen Ortskirche „immer weiter vom gemeinsamen Weg der Weltkirche zu entfernen drohen“, erwähnte Bätzing nicht.
Er hielt an der nächsten Sitzung des Synodalen Ausschusses im Juni wie an allen Plänen des Synodalen Wegs nach wie vor fest. Die Worte des ehemaligen ZdK-Chefs Sternberg vom Vorjahr hallten weiter nach: „So wie ich den Vatikan und seine unglaublichen Beharrungskräfte und Borniertheiten einschätze, kommt man nur weiter, indem man vollendete Tatsachen schafft“ — was hinter vorgehaltenener Hand mehr als einmal wiederholt wurde.
Man sieht Papst Leo auf seiner Seite
Dass Tatsachen geschaffen wurden, daran konnten auch alle Gespräche, die zwischen Deutschland und Rom stattgefunden haben, nichts ausrichten. Man sei in gutem Austausch, hieß es immer von Seiten des DBK-Chefs. Der hat mit dem Synodalen Ausschuss inzwischen die Satzung für das neue Gremium auf Nationalebene beraten. Der Name des Gremiums wurde geändert, der Inhalt nicht. Der jetzige Entwurf soll im November abschließend beraten werden.
Papst Leo, der inzwischen Papst Franziskus abgelöst hatte, sieht man bereits auf seiner Seite. Bei der letzten Vollversammlung der Bischöfe erklärte Bätzing, keine Widersprüche zwischen dem, was Leo im ersten großen Interview gesagt habe und dem zu sehen, was in Deutschland in puncto Segensfeiern etabliert werde. Das Schreiben „Fiducia Supplicans" interpretieren die Deutschen auf ihre Art.
Da hilft es auch nichts, wenn Glaubenspräfekt Victor Fernandez persönlich klarstellt, dass man in Rom zur Handreichung keineswegs konsultiert worden war und dem deutschen Vorhaben erst recht kein grünes Licht gegeben hat. Ebenso wenig horchen die Deutschen auch nicht auf, wenn Kirchenrechtler wie der Münsteraner Thomas Schüller trocken feststellen, dass nach den Aussagen des Papstes für den Synodalen Weg in Deutschland viele Beschlüsse „zum Beispiel zur Sexualmoral und zur Weihe von Frauen Makulatur“ seien. Deutschlands Kirche hat eine andere Realität. Und sie läuft zumeist unterm Radar.
Die Printausgabe der Tagespost vervollständigt aktuelle Nachrichten auf die-tagespost.de mit Hintergründen und Analysen.