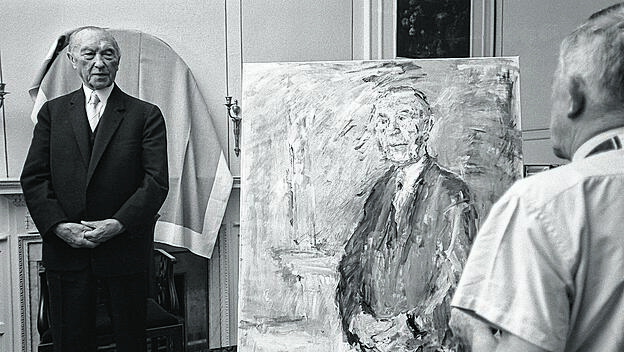Nach der gelungenen Premiere im vergangenen Jahr haben die "Josef-Pieper-Stiftung" und das Kölner "Lindenthal-Institut" ihre Kooperation zu Piepers Interpretation der Dialoge Platons fortgesetzt. Instituts-Direktor Johannes Hattler konnte zu dem innovativen Format, das aus Vortrag, Film und einem weiteren Vortrag vom Band sowie sich jeweils anschließender Aussprache bestand, rund fünfzig Interessierte in den Räumlichkeiten des Lindenthal-Instituts begrüßen. Unter der Überschrift "Wortmissbrauch und Macht - Philosophieren mit den platonischen Dialogen" widmeten sie sich diesmal dem "Gorgias". Ähnlich wie im letzten Jahr stand dabei auch diesmal eines der drei von Pieper konzipierten, vom Bayerischen Rundfunk produzierten und mit professionellen Schauspielern besetzten Fernsehspiele im Zentrum.
Pieper siedelte Platons "Gorgias" im zeitlos Menschlichen an
Wer Josef Pieper (1904-1997) bisher nur als kongenialen Interpreten des heiligen Thomas von Aquin (1224/5-1274) wahrgenommen hat, mag das vielleicht überraschen. Doch wie der Vorstand der Josef-Pieper-Stiftung, der Philosoph und Thomas-Spezialist Hanns-Gregor Nissing, in seiner Hinführung erläuterte, habe Pieper Platon stets als seinen "zweiten Lehrer" betrachtet. Für das erstmals 1962 in der ARD und im Österreichischen Fernsehen (ORF) zeitgleich ausgestrahlte TV-Spiel "Wortmissbrauch und Macht - Ein Abend mit dem Gorgias des Platon" habe Pieper den "Gorgias" nicht nur eigenhändig übersetzt, sondern den Text auch aus seinem historischen Kontext herausgelöst und im "zeitlos Menschlichen" angesiedelt.
Und so schlüpft für das 86-minütige Fernsehspiel zunächst ein Hochschulprofessor, der die anderen Personen zu sich nach Hause einlädt, in die Rolle des Sokrates. Beim gemeinsamen Gespräch, das im Fernsehen der 60er Jahre offenbar noch völlig bedenkenlos durch den Konsum von Wein und allerlei Rauchwaren befördert werden konnte, übernimmt sodann ein Schriftsteller den Part des Gorgias, während ein Journalist, der in Begleitung seiner Lebensgefährtin erscheint, den Pollos mimt und ein Politiker sich in der Rolle des Kallikles wiederfindet.
Die Sophistik in die Gegenwart geholt
Mit diesen Kunstgriffen gelang es Pieper, die Sophistik, die ja auch tatsächlich keineswegs mit dem klassischen Athen untergegangen ist, in die Gegenwart der damals noch jungen Bundesrepublik zu holen und ihre problematischen Axiome einem Millionenpublikum vor Augen zu führen. Dass Vergleichbares heute nahezu utopisch erscheinen muss, obgleich sich Fake News und Framing in den traditionellen Medien genauso finden lassen wie in den Sozialen Netzwerken, mag auch am gesunkenen Bildungsniveau vieler TV-Zuschauer liegen. Vor allem aber dürfte es an der offenbar gewachsenen Akzeptanz der Sophistik in Politik, Medien, Kultur- und Wissenschaftsbetrieb und deren kaum beobachtbaren Fähigkeit zur Selbstkritik scheitern. Wie auch immer: Selten schien die Beschäftigung mit einem klassischen Text derart aktuell zu sein wie am vergangenen Samstag in Köln.
Gegen Ende des Seminars stand die Auseinandersetzung mit einem Vortrag auf dem Programm, den Pieper 1964, im Beisein von Bundespräsident Heinrich Lübke, auf der Jahrestagung der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) gehalten hatte und dem er, wie Berthold Wald verriet, entgegen seiner sonstigen Angewohnheit mit einer gewissen Nervosität entgegensah. Der Vortrag, der sich auch in dem von Wald herausgegebenen und im Verlag Meiner erschienenen Gesamtwerk Piepers findet, trägt den Titel "Missbrauch der Sprache - Missbrauch der Macht" und löste damals offenbar eine Vielzahl positiver Reaktionen aus. Als Audio-Datei findet er sich zudem, wie einige andere auch, auf der Webseite der Josef-Pieper-Arbeitsstelle.
Wort und Sprache als Medium der geistigen Existenz
Für die Teilnehmer der Tagung hatte der Vortrag Piepers, aus dessen Aufzeichnung Nissing einzelne Passagen auswählte, den unabweisbaren Vorteil, dass sie ihre eigenen Interpretationen des von Pieper für das Fernsehen bearbeiteten Gorgias nun mit dessen eigenen abgleichen konnten. Ausgehend von dem positiven Bild, dass Philosophen wie Bertrand Russell, Werner Jaeger oder Karl Vorländer von den Sophisten gezeichnet hatten, fragt Pieper, was Platon und sein Schüler Aristoteles den Sophisten eigentlich vorwürfen. Piepers Antwort: "Das eigentlich Schlimme an der Sophistik sieht Platon, scheint mir, darin, dass sie mit einer enormen Sensibilität für die sprachliche Nuance und mit einem Höchstmaß an formaler Intelligenz das Wort kultiviere, ja den Wortgebrauch zu einer Kunst vervollkommne - und zugleich den Sinn und die Würde des Wortes verderbe." Weil "Wort und Sprache" aber "das Medium der geistigen Existenz" der Menschen seien, könne, "wenn das Wort verdirbt", auch "das Menschsein" weder "unbetroffen" noch "unversehrt" bleiben.
Wie nun aber verderben Wort und Sprache? Pieper findet die Lösung in ihrem gewöhnlichen Gebrauch, der ein zweifacher sei: "Das erste ist: dass im Worte Realität deutlich wird; man redet, um in der Benennung etwas Wirkliches kenntlich zu machen, kenntlich für jemanden, natürlich. Ebendas ist das zweite: der Mitteilungscharakter des Wortes." Wörter seien sowohl "Sach-Zeichen" für etwas als auch "Zeichen" für jemanden. Nämlich für den, "dem Realität vor Augen gebracht werden soll". Beide Aspekte ließen sich zwar "unterscheiden", seien aber nicht "voneinander zu trennen". "Es gibt das eine nicht ohne das andere." Wer spreche, wolle mitteilen. "Was aber könnte einer einem anderen mitteilen, wenn nicht etwas, das sich wirklich so verhält."
Ständig wiederkehrende Klage und Anklage
Natürlich sei der Mensch auch der Lüge fähig. Aber, fragt Pieper, sei die Lüge noch "eine Mitteilung - wenn doch der Belogene nur zum Schein Anteil an der Realität" gewänne? Seine Antwort folgt auf dem Fuße: "Verderb des Realitätsbezugs, Verderb des Mitteilungscharakters - das sind offenbar die beiden möglichen Gestalten der Korrumpierung des Wortes." Beides lege "Sokrates der sophistischen Rhetorik zur Last". "Es ist, in Platons Dialogen, eine ständig wiederkehrende Klage und Anklage: ,Um die Sache, meint ihr, braucht man sich nur soweit zu kümmern, dass man eindrucksvoll darüber reden kann [Gorgias 459 b 8ff]; und eben deswegen seid ihr untauglich zum Dialog; ihr ,redet , aber ihr ,unterredet euch nicht! [Protagoras 336 b 1ff; 336 c 4ff]" "Wiederum" sei "das eine nicht von dem anderen zu trennen". Die "von der Norm der Sache sich emanzipierende Rede" sei "zugleich" und "notwendigerweise" eine "partnerlose Rede".
Wer "in bewusster Handhabung des Wortes" rede und wem es dabei "auf etwas anderes ankommt als auf Wahrheit, der betrachtet wirklich, von da an, den anderen nicht mehr als Partner; er respektiert ihn nicht eigentlich mehr als menschliche Person; genau genommen findet, von da an, überhaupt kein Gespräch mehr statt, kein Dialog, kein Miteinanderreden!" Aus dem "Mit-Subjekt" werde so "ein zu ,bearbeitendes Objekt", das "Objekt eines Bemächtigungsversuchs, das einer ,Behandlung ausgesetzt wird." Und in "demselben Maße", in dem das Wort dabei eine Rolle spiele, höre es auf, "wirklich etwas mitzuteilen". Stattdessen erfolge "ein im Grunde partnerloses Reden". Eines, das "im Widerspruch zur Natur" der Rede stehe. Eben weil ein solches Reden "nicht etwas besagt, sondern etwas bezweckt". Das Wort sei, so Pieper weiter, "denaturiert und degradiert zum, Wirkstoff , zur Droge, die man verabreicht; es ist zum bloßen Mittel geworden, wie ein Gerät oder Requisit."
All dies trifft, folgt man Pieper in seinem Vortrag vor der DFG genauso wie Platons Gorgias, nicht bloß auf die Lüge zu, sondern mindestens im gleichen Umfang auch auf die Schmeichelei. Pieper: "Wo immer den Menschen absichtsvoll nach dem Munde geredet wird, da verdirbt das Wort, notwendigerweise; und an die Stelle echter Kommunikation tritt etwas, wofür der Ausdruck ,Machtverhältnis ein viel zu positiver Name wäre. Eher handelt es sich um so etwas wie Tyrannei, um eine durch keine wirkliche Überlegenheit ausgewiesene Pseudoführung, welcher auf dem anderen Ufer eine gleichfalls nicht wirklich begründete Abhängigkeit entspricht, die besser ,Hörigkeit heißen sollte."
Es fällt nicht schwer, dies mit dem Populismus in Verbindung zu bringen, der aktuell, in Deutschland wie andernorts, ständig neue Blüten treibt. Doch auf der Tagung spielte dies, von Pausengesprächen einmal abgesehen, erstaunlicherweise so gut wie keine Rolle. Stattdessen waren die Teilnehmer vollauf damit beschäftigt, die Texte zu befragen und ihre Befunde mit anderen philosophischen Konzepten in Beziehung zu setzen und abzugleichen. Nissing und Wald blieben dabei nicht nur keine Antwort schuldig, sondern sortierten diese auch, so sympathisch wie zuverlässig, auch gleich noch nach Schulen und Epochen und sorgten so für eine Weitung der Horizonte.
2025: Josef-Pieper-Preis geht an Bischof Robert Barron
Im Beisein des Gründers und langjährigen ehemaligen Direktors des Lindenthal Instituts, Hans Thomas, lud Nissing am Ende der Tagung zu einer Veranstaltung, die bei einigen große Begeisterung hervorrief. Im kommenden Jahr werde die Josef-Pieper-Stiftung wieder den Josef-Pieper-Preis im Rahmen eines Symposiums in Münster verleihen. Nach Charles Taylor (2004), Remi Brague (2009), Rüdiger Safranski (2014) und Hanna-Barbara Gerl-Falkovitz (2019), werde dann Bischof Robert Barron den Josef-Pieper-Preis erhalten. Der Oberhirte der im US-Bundesstaat Minnesota gelegenen Diözese Winona-Rochester, der immer auch noch als Hochschullehrer aktiv ist, gilt als intimer Kenner sowohl der Werke des doctor angelicus als auch der Josef Piepers. Mit seinem "World on Fire" genannten Evangelisierungswerk erreichen Bischof Barron und seine Mitstreiter weltweit jedes Jahr Millionen Menschen.
Die Printausgabe der Tagespost vervollständigt aktuelle Nachrichten auf die-tagespost.de mit Hintergründen und Analysen.