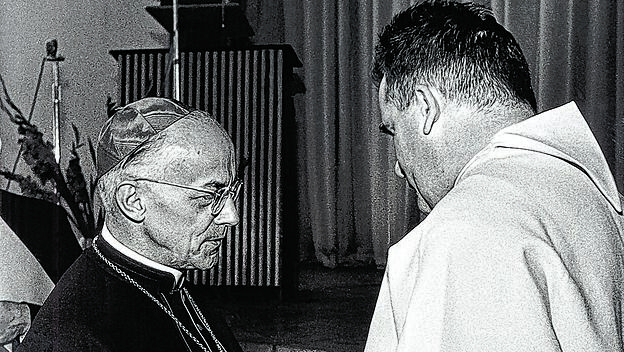Herr Schindler, in Ihrem Buch „Die Politik des Realen“ kritisieren Sie den Liberalismus. Der Ausdruck „liberal“ kann in verschiedenen Sprachen unterschiedliche Bedeutungen haben. Was meinen Sie mit „Liberalismus“?
Wenn ich von „Liberalismus“ spreche, denke ich an die anglo-amerikanische politische Philosophie, die manchmal auch als klassischer Liberalismus bezeichnet und mit Denkern wie John Locke und Thomas Hobbes in Verbindung gebracht wird. Aber man kann den Liberalismus auch inhaltlich charakterisieren. Als politische Philosophie geht es mehr oder weniger um das, was man als Gesellschaftsvertragstheorie bezeichnen könnte. Der Liberalismus ist der Überzeugung, dass der Zweck der politischen Ordnung darin besteht, der Freiheit des Einzelnen so viel Raum wie möglich zu geben. Sie wird als das wichtigste Gut angesehen und alles andere um sie herum organisiert.
Was ist falsch am Liberalismus? Hat er nicht zu wirtschaftlich prosperierenden Demokratien geführt, die die Rechte des Einzelnen schützen?
Die Erfolge muss man anerkennen. Die Sklaverei zum Beispiel gibt es in liberalen Gesellschaften nicht. Auch die Möglichkeiten von Menschen, die in ärmlichen Verhältnissen geboren werden, ein erfolgreiches Leben zu führen, wurden stark verbessert. Das Problem mit dem Liberalismus ist jedoch viel tiefgreifender, als wir bisher erkannt haben, und ich glaube, wir fangen erst jetzt an zu verstehen, was wir uns mit Liberalismus eingehandelt haben.
Bitte erläutern Sie.
Auf den ersten Blick scheint es so, als würde der Liberalismus keine bestimmte Vorstellung vom Guten, keine bestimmte religiöse Überzeugung oder keine bestimmte Tradition in Frage stellen. Die Idee des Liberalismus ist, dass nichts davon wesentlich ist für die Frage, wer man ist. Es stehe jedem frei zu entscheiden, ob und woran er sich bindet. Das Problem ist, dass wir das Wesen des Guten, der Religion und der Tradition tiefgreifend verändern, wenn wir sie zu Objekten der Wahl umgestalten, anstatt sie als Realitäten zu begreifen, die uns vorausgehen, unsere Existenz begründen und uns überhaupt erst in die Lage versetzen, Entscheidungen zu treffen. Der Liberalismus beseitigt das, was die klassische Tradition das Gutsein aller Güter nennt. Das Gute impliziert einen Anspruch, eine Anziehungskraft, die auf mich einwirkt, bevor ich meinen Willen einsetze, um es zu wählen oder ihm zu widerstehen. Es besteht ein radikaler Unterschied zwischen einem Gut und einer bloßen Option. Der Liberalismus verwandelt alle Güter in Optionen.
Der Begriff des Eigentums ist für den Liberalismus von grundlegender Bedeutung. In Ihrem Buch verweisen Sie auf Hegels Begriff des Privateigentums als eine Alternative zur liberalen Auffassung. Können Sie den Unterschied erläutern?
Die Konzeption einer politischen Ordnung beruht immer auf einem Verständnis von der Natur des Eigentums. John Locke versteht die politische Ordnung als Schutz und Ermöglichung des Erwerbs von Privateigentum. Bei ihm hat man den Eindruck, als gehöre die Welt in ihrem natürlichen Zustand niemandem. In gewissem Sinne ist sie wertlos, solange der Mensch nicht an ihr arbeitet. Das Privateigentum entsteht, wenn die menschliche Tätigkeit einen Teil der Welt aus der öffentlichen Sphäre herausnimmt und ihn privat und gleichzeitig wertvoll macht. Bei Hegel hingegen geht diese Bewegung in die andere Richtung: Wenn man etwas besitzt, bindet man sich an eine Wirklichkeit, die über einen selbst hinausgeht. Es gibt einen Eintritt in die öffentliche Sphäre, die mit dem Eigentum einhergeht. Also liegt es in der Natur des Eigentums, dass es Verantwortung mit sich bringt. Man bindet sich selbst, also muss man sich um diese Sache kümmern, sie hegen und pflegen. Und weil das Eigentum einen Eintritt in die öffentliche Sphäre bedeutet, können im Prinzip auch andere daran teilhaben.
In den letzten Jahren ist der so genannte Integralismus als Alternative zum Liberalismus recht populär geworden, insbesondere unter traditionell eingestellten Katholiken in den USA. Wie sollten wir den Begriff „Integralismus“ Ihrer Meinung nach am besten verstehen?
Der Begriff hat seine Wurzeln in Bewegungen in Frankreich, Portugal und Spanien Anfang des 20. Jahrhunderts. Das Wesentliche ist jedoch nicht die Geschichte, sondern der Grundgedanke, dass die Politik auf das Gemeinwohl ausgerichtet ist. Außerdem muss das Gemeinwohl der menschlichen Natur angemessen sein. Und die menschliche Natur hat eine natürliche und eine übernatürliche Dimension. Wir haben ein Gut, das unser Leben auf der Erde bestimmt. Aber der Mensch ist noch mehr. Er hat auch eine eschatologische Bestimmung. Und weil diese Teil des gesamten menschlichen Gutes ist, muss es in der politischen Ordnung vertreten sein. Daraus ergibt sich die Notwendigkeit für die Kirche, wieder eine politische Präsenz zu entwickeln, um die übernatürliche Dimension des Gemeinwohls in der Politik zu vertreten. So weit, so gut. Aber meiner Meinung nach neigen diejenigen, die sich als „Integralisten“ bekennen, dazu, diese politische Präsenz im Sinne von Zwangsgewalt zu konzipieren. Ich glaube, dass dies letztlich das politische Grundmodell des Liberalismus stärkt. Was wir stattdessen brauchen, ist eine Rückbesinnung der Kirche auf die richtige Art von Autorität, die sich von der Zwangsgewalt unterscheidet.
Wie lässt sich eine so weit gefasste integralistische Sicht der Politik mit der Betonung der Religionsfreiheit nach dem Zweiten Vatikanum vereinbaren? Ich denke dabei insbesondere an „Dignitatis humanae“.
Einige Integralisten werden argumentieren, dass eine erneute Lektüre von „Dignitatis humanae“ zeigen kann, dass, wenn man genau auf die Formulierungen achtet, so etwas wie ein konfessioneller Staat noch möglich ist. Dafür habe ich eine gewisse Sympathie. Die Kritiker des Integralismus neigen dazu, eine liberale Auffassung von Religionsfreiheit vorauszusetzen. Sie denken, dass die einzig mögliche Bedeutung der Religionsfreiheit eine Art neutraler Raum ist, der unterschiedslos jede Art von religiösem Glauben zulässt. Das führt dazu, dass alle religiösen Überzeugungen unterminiert werden.
Warum ist das so?
Ein eher anekdotisches Argument, das ich aber erhellend finde, lautet wie folgt: Als gläubiger Katholik ist meine katholische Identität wesentlich für mich und wesentlich für mein Selbstverständnis. Ich fühle mich zum Beispiel mit einem gläubigen Juden in gewisser Weise wohler als mit einem modernen Liberalen. Der Jude würde meinem Christentum wahrscheinlich in gewisser Weise kritischer gegenüberstehen, weil er das Judentum für wahr hält, und dennoch würde ich mich davon weniger bedroht fühlen als von einem Liberalen. Denn dieser würde religiöse Überzeugungen überhaupt nicht ernst nehmen. Auf eine seltsame Art und Weise hat man, indem man alle religiösen Überzeugungen zu einer Wahlmöglichkeit macht, dafür gesorgt, dass sie nicht mehr im eigentlichen Sinne religiös sind. Man hat ein echtes Gut in eine bloße Option verwandelt. Der Liberalismus verändert also das Wesen der Religion. Wenn man auf dieser Auffassung von Religionsfreiheit besteht, beseitigt man die Möglichkeit von Religion im traditionellen Sinn. Ich kann mir eine politische Ordnung vorstellen, die sich auf die Autorität der Wahrheit der christlichen Tradition stützt und die gerade auf der Grundlage der Ressourcen, die diese besondere Tradition bietet, anderen Religionen gegenüber respektvoll sein kann. Ich denke, das ist näher an dem, was „Dignitatis humanae“ im Sinn hat, als die typische liberale Lesart.
Sie behaupten, katholische Politik sei eine „Politik des Realen“. Was meinen Sie damit?
Eine Politik des Realen wäre einfach die Anerkennung, dass Politik etwas anderes ist als nur ein abstraktes System von „Checks and Balances“, in dessen Mittelpunkt Gerechtigkeit als Fairness, Verfahrensgerechtigkeit und so weiter stehen. Stattdessen müssen wir erkennen, dass die politische Ordnung aus dem realen Engagement für reale Dinge und reale Gemeinschaften erwächst.
Heißt das, dass die menschliche Natur und die Besonderheiten einer sich aus dieser Natur ergebenden Kultur – ihre Geschichte und Traditionen – die Grundlage der Politik sein müssen?
Ja. Der zum Katholizismus konvertierte Historiker Christopher Dawson vertrat die Auffassung, dass Kultur verkörperte Religion sei. Man könnte auch sagen: Kultur ist der organische, an einem bestimmten Ort und zu einer bestimmten Zeit sich ereignende Ausdruck einer Vorstellung davon, was es bedeutet, Mensch zu sein und was unsere letzte Bestimmung ist. Diese Überzeugungen kommen in der Art und Weise zum Ausdruck, wie wir unsere Städte, unsere Haushalte und unsere Volkswirtschaften organisieren. Die Politik des Realen würde einfach darin bestehen, dies explizit zu machen und anzuerkennen, dass Politik aus unserer Beziehung zu realen Dingen erwächst.
Wie sind die Aussichten für eine solche Politik des Realen in den USA oder in Europa in absehbarer Zeit? Sind wir als Katholiken nicht damit beschäftigt, um unser bloßes Überleben zu kämpfen?
In gewisser Weise sind wir sowohl näher dran als auch weiter entfernt als je zuvor. Weiter entfernt, weil wir in unserer Kultur den Sinn dafür verloren haben, was es heißt, ein Mensch zu sein. Und man könnte meinen, dass dies so weit wie möglich von einer katholischen Vision entfernt ist. Aber paradoxerweise stellen wir jetzt Fragen und entwickeln eine Art Hunger nach Alternativen in einer Weise, die vor 20, 30 oder 40 Jahren nicht möglich gewesen wäre. Ich glaube, wir beginnen zu erkennen, dass wir wieder einen Sinn für Ordnung brauchen. Denn wie Simone Weil sagte, ist das größte aller menschlichen Bedürfnisse das Bedürfnis nach Ordnung.
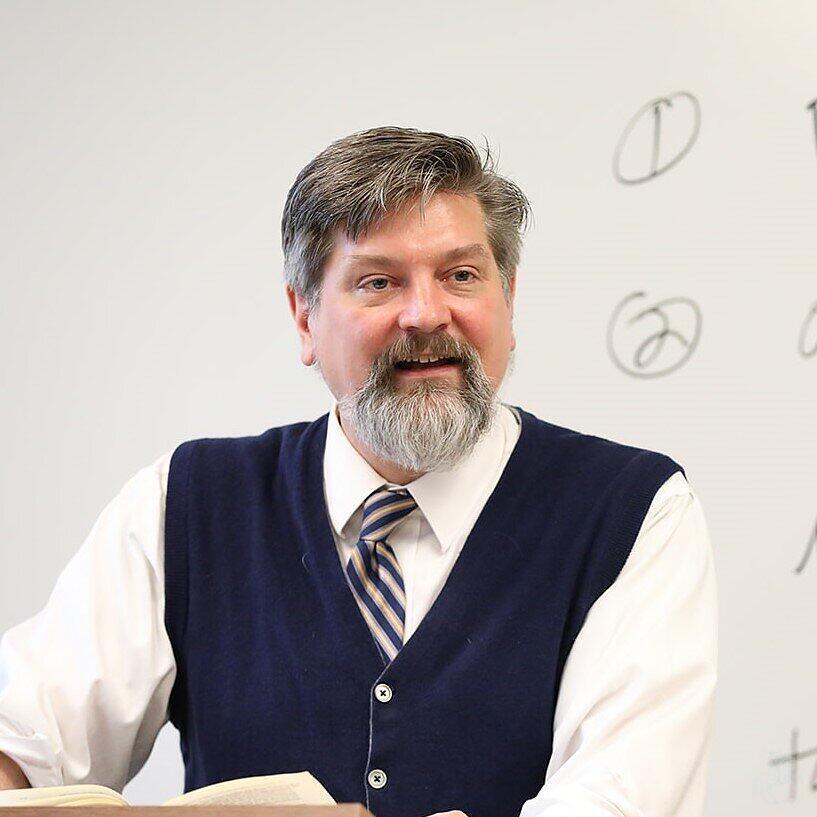
Die Printausgabe der Tagespost vervollständigt aktuelle Nachrichten auf die-tagespost.de mit Hintergründen und Analysen.