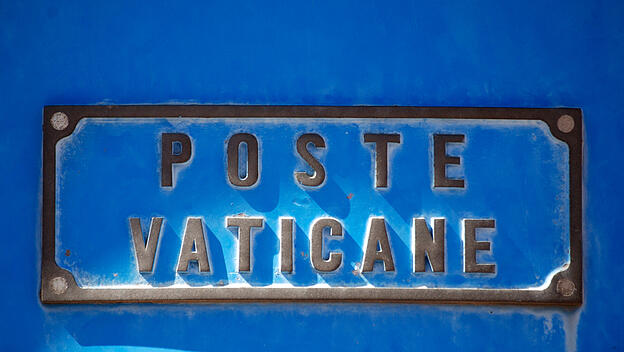Die vierte Vollversammlung des Synodalen Wegs hat den Grundtext aus dem Synodalforum III, "Frauen in Diensten und Ämtern in der Kirche" mit deutlicher Mehrheit angenommen. 182 Synodalteilnehmer stimmten insgesamt für das Papier, 16 dagegen. Sieben enthielten sich. Auch die Bischöfe stimmten deutlich dafür: 45 Ja-Stimmen standen zehn Nein-Stimmen und fünf Enthaltungen gegenüber.
Abstimmung nach langer Diskussion
Die Abstimmung über den „Grundtext“ erfolgte nach mehrstündiger Diskussion. Im Zentrum des Papiers stand die Frage, ob grundsätzlich alle Ämter in der Kirche – auch jene, die mit der Weihe verbunden sind – Frauen offen stehen dürfen. Dorothea Sattler, zusammen mit Bischöfe Franz-Josef Bode Vorsitzende des gleichnamigen Forums III, sagte bei der Vorstellung des Textes, begründet werden solle nicht, warum Frauen zu (Weihe-)Ämtern zugelassen werden, sondern warum sie nicht dazu zugelassen werden sollten.
Bereits in der Pressekonferenz hatte die Ko-Vorsitzende des Synodalen Weges und Vorsitzende des Zentralkomitees der Deutschen Katholiken, Irme Stetter-Karp, vor „heimlichen Blockieren“ gewarnt. Nach dem gestrigen „Eklat“, als die Zweidrittelmehrheit der Bischöfe nicht zustande kam, wandte sie sich direkt an sie: „Wer nicht spricht und dann auf den roten Knopf mit Nein drückt, missbraucht das Vertrauen“. Sie sprach sich gegen „zementierte, strategische Blockaden“ aus.
Aufgabe, lehramtliche Aussagen zu prüfen
Für die sogenannte „Antragskommission“ des Synodalen Weges kommentierte den Antrag Margit Eckholt. Hierbei gehe es „um Geschlechtergerechtigkeit, nicht nur um den Zugang zu Ämtern, sondern um Würdigung und Wertschätzung der Frauen in allen Diensten und Ämtern der Kirche.“ Sie bezog sich auf die „Verbindlichkeit kirchlicher Lehre“, insbesondere um die Auseinandersetzung mit dem Apostolischen Schreiben „Ordinatio sacerdotalis“ von Johannes Paul II. (1994), das die Möglichkeit einer Priesterweihe der Frau endgültig verneint: „Wir haben die Aufgabe, auch diese lehramtlichen Aussagen zu prüfen“. Das Lehramt des Papstes sei „von Bedeutung“, aber ebenso „alle Stimmen im Volke Gottes, das sensum fidelium aller Menschen des Volkes Gottes“.
Margit Eckholt nannte auch die „Argumentationsfigur“, auf die in dem Zusammenhang rekurriert und die in Deutschland in letzter Zeit intensiv diskutiert werde – dass der Priester „in persona Christi capitis“ handele, die sogenannte „Braut-Bräutigam-Metapher“ – als „überwundene Geschlechterpolarität“.
Darin entzündete sich die Diskussion. Der Regensburger Bischöfe Rudolf Voderholzer sagte dazu, die Aufgabe des Bischöfe sei nicht „das Fragezeichen“ hinter „Ordinatio sacerdotalis“ noch zu vergrößern, sondern hinter das päpstliche Schreiben mit guten theologischen Gründen „ein Ausrufezeichen zu setzen“. Die Braut-Bräutigam-Metaphorik sei keine überkommene, veraltete Vorstellung, sondern „die Basis für die Sakramentalität der Ehe und biblisch sehr gut begründet“. Kardinal Rainer Woelki wies darauf hin, dass mit „Ordinatio sacerdotalis“ und der „entsprechenden Äußerung der Glaubenskongregation, die die dogmatische Einordnung dieses Textes vorgenommen hat“, die Frage abgeschlossen sei.
Schlosser: Kirchliche Tradition als Maßstab
Ähnlich äußerte sich etwa die Synodale Dorothea Schmidt: „Mir ist es schleierhaft, wie wir Probleme lösen wollen gegen das Lehramt, die gesamte Tradition der letzten drei Päpste, von denen eine knapp unter dem Dogma liegt.“ Auch die Theologin Marianne Schlosser sprach sich gegen den Grundtext aus, insbesondere gegen die „Zeichen der Zeit“: „Um die Zeichen der Zeit zu erkennen, darf man nicht nur Kind der eigenen Zeit sein“. Der Maßstab dafür seien die Kirche und die kirchliche Tradition.
Obwohl dennoch die Stimmen – auch von Bischöfe – deutlich überwogen, die sich für die Annahme des Grundtextes aussprachen, bat der Vorsitzende der Bischofskonferenzen und des Synodalen Weges, der Limburger Bischöfe Georg Bätzing, um eine Auszeit, um sich mit den Bischöfe in einem separaten Raum zu treffen. Hinterher erklärte er dazu: „Es ging dabei um ein Stimmungsbild. Ich bin zuversichtlich, dass die erforderliche Zweidrittelmehrheit zustande kommt.“
Als eine Art Kompromiss brachte Bischof Bätzing einen Änderungsantrag in die Versammlung ein: Der Hinweis, ob die Lehre von „Ordinatio sacerdotalis“ geprüft werden müsse, solle als „Anfrage an die höchste Autorität in der Kirche (Papst und Konzil)“ gestellt werden. Dieser Hinweis, der irgendwo im Text versteckt war, sollte direkt in die Einleitung verschoben werden. Dadurch sollte klargestellt werden, dass der Grundtext keinerlei rechtliche Bindung entfaltet, sondern als Anfrage an „Rom“ und in die Weltkirche, etwa in die weltweite Synode 2023, eingebracht werden soll. DT/jg
Lesen Sie ausführliche Hintergründe, Berichte und Analysen zur vierten Synodalversammlung in der kommenden Ausgabe der "Tagespost".