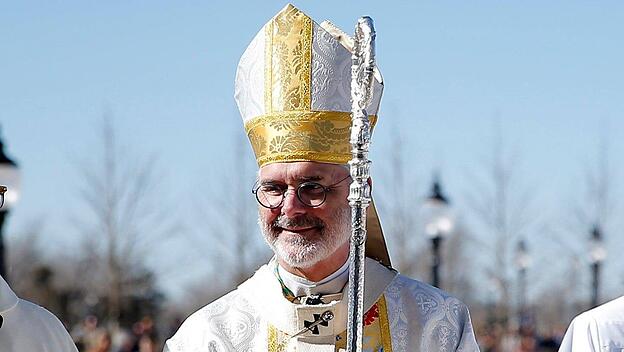Der Liberalismus ist gescheitert, weil er erfolgreich war: So lautet die Kernthese postliberaler Theoretiker wie dem Harvard-Professor Patrick Deneen. Um ihn herum hat sich ein Zirkel akademischer „postliberaler“ Theoretiker gebildet, die für eine neue konservative, christliche und nationalistische Politik plädieren. Einer von ihnen ist der US-Politikwissenschaftler Gladden Pappin. Gemeinsam mit Deneen und anderen betreibt er den Blog „Postliberal Order“. Pappin war Gastwissenschaftler am ungarischen „Mathias Corvinus Collegium“ (MCC), das der Regierung von Ministerpräsident Viktor Orbán nahesteht. Derzeit leitet er das Ungarische Institut für Auswärtige Angelegenheiten (HIIA).
Herr Pappin, Leo XIV. ist der erste Papst, der aus den Vereinigten Staaten kommt. Welche Herausforderungen werden sein Pontifikat prägen?
Ich denke, die Kirche steht vor einer Vielzahl von Herausforderungen, was ihr Verhältnis zur modernen Welt angeht. Die Menschen haben ganz andere Erwartungen als in den 1960ern, 70ern oder auch noch den 90ern. In der Zeit nach dem Kalten Krieg herrschte viel Optimismus unter den westlichen Eliten, was die Verbreitung des liberalen Kapitalismus angeht. Auch Johannes Paul II. befasste sich in seinen Enzykliken damit. Der Kirche ist es stets gelungen, ihre langfristigen, ewigen Glaubenssätze aufrechtzuerhalten, während sie gleichzeitig auf aktuelle Themen reagierte. Es scheint, dass Leo auch mit der Wahl seines Namens auf die neuen Herausforderungen für die Menschenwürde und die Würde der Arbeit antworten möchte, die von den schnellen technologischen Veränderungen um uns herum bedroht sind. Es scheint, als hätte er ein sehr tiefes Bewusstsein für diese Veränderungen.
Die Trump-Regierung hat immer wieder den christlichen Glauben betont. Sehen Sie, dass sich jetzt neue Felder der Zusammenarbeit zwischen Washington und dem Vatikan auftun?
Der Heilige Stuhl ist eine international anerkannte Institution, daher pflegen die USA und der Vatikan förmliche Beziehungen auf diplomatischer Ebene. In Anbetracht der Tatsache, dass mit J.D. Vance ein Katholik das Amt des Vizepräsidenten ausübt, der seinen Glauben aufrichtig bezeugt, werden sich zwangsläufig neue Synergien ergeben. US-Katholiken machen einen großen und florierenden Teil der amerikanischen Politik aus. Es gibt viele Republikaner, aber auch Demokraten unter den Katholiken. Ich bin sicher, der Heilige Vater wird mit Wohlwollen auf alle Katholiken in den USA schauen. In der Politik ist ein kluger Umgang mit den verschiedenen Positionen zu aktuellen Themen notwendig. Doch natürlich können auch Menschen desselben Glaubens unterschiedlicher Meinung in politischen Fragen sein.
Vizepräsident J.D. Vance besuchte Franziskus vor seinem Tod. Die Beziehung der beiden war allerdings von einem Disput über die Migrationspolitik geprägt. Werden die Spannungen in dieser Frage unter Leo XIV., den Vance auch schon getroffen hat, abnehmen?
Wenn es zu Meinungsverschiedenheiten zwischen Regierungen und religiösen Institutionen kommt, finden diese häufig auf unterschiedlichen Sprachebenen statt. In den vergangenen zehn Jahren, insbesondere während der Migrationskrise in Europa, hat die Kirche ihre Stimme ganz primär für Menschen in Not erhoben, die in den westlichen Gesellschaften strandeten. Es ist eine schwierige Frage, wie die Verpflichtung der Kirche zur Barmherzigkeit in Einklang gebracht werden kann mit der Verpflichtung von politischen Amtsträgern, Gesetz und Gerechtigkeit aufrechtzuerhalten. Doch Papst Leo scheint mir eine sehr väterliche, bedachte und engagierte Figur zu sein. Daher werden wir sicher viele produktive Diskussionen erleben, selbst bei Themen, bei denen es zuletzt Unstimmigkeiten gab.
Wir erleben in den USA gerade eine grundlegende politische Neuausrichtung. Sie haben immer wieder von einer Anpassung an eine postliberale Welt gesprochen. Was meinen Sie mit postliberal?
Ich denke, wir müssen uns fragen, welche Erwartungen wir an unsere sich immer schneller entwickelnde Welt haben, und welche intellektuellen Werkzeuge notwendig sind, um sie bestmöglich zu verstehen. Viele von uns sind in einer Welt aufgewachsen, in der man davon ausging, dass der globale Liberalismus, wie man ihn nach dem Ende des Kalten Kriegs erlebt hat, sich weiter ausbreitet und nach und nach alles beherrscht. Diese Form des Liberalismus stellte eine sich immer weiter ausdehnende Vorstellung der menschlichen Freiheit in den Mittelpunkt. Konzepte wie die Gender-Identität oder uneingeschränkte Wahlfreiheit fielen nun unter diesen Liberalismusbegriff. Vom Wirtschaftssystem erwartete man, dass es sich in eine ähnliche Richtung bewegen würde. Vor allem in den USA verlagerte sich die Arbeit in den Dienstleistungssektor und ins Digitale, während die klassischen Betätigungsfelder wie die Schwerindustrie oder das verarbeitende Gewerbe ins Ausland verschwanden. Alle gingen davon aus, dass alle in dieser Welt zufriedener und reicher werden würden. Stattdessen scheinen wir in eine Welt einzutreten, in der sich das Stammesdenken immer mehr verbreitet, eine Welt, die zunehmend auseinanderbricht und in der sich Identitäten auflösen. Die Ausbreitung der Marktwirtschaft hat nicht zu einer schnellen Demokratisierung aller Erdteile geführt. Kurzum: Die liberalen Erwartungen werden nicht länger erfüllt.
Und was halten Postliberale dagegen?
Postliberale plädieren für eine Rückkehr zum klassischen, auf Aristoteles beruhenden Politikverständnis, sie heben die Bedeutung des Römischen Rechts in seiner klassischen, auf dem Naturrecht basierenden Form und Rechtsauslegung hervor. Sie setzen auf die Bedeutung des Christentums, zumindest als Ordnungsprinzip des Westens. Und sie sprechen sich für eine gewisse Art von Realismus in internationalen Angelegenheiten aus. Diese Sichtweise findet immer mehr Verbreitung. Es gibt nicht das eine treffende Wort für das Gesamtpaket – Postliberalismus ist ein Oberbegriff, der mehrere unterschiedliche Versionen umfasst.
Kann man Donald Trump als den ersten postliberalen Präsidenten bezeichnen?
Ich denke, Trump ist sich seit den 1980ern darin treu geblieben, den Erfolg des globalen Freihandelssystem anzuzweifeln, das damals aufkam. Seine Sichtweise gewann schließlich an Aktualität, nachdem die Amerikaner merkten, dass die Institutionen, die in den 1990ern und frühen 2000ern eingerichtet worden waren, sie verraten hatten. Es ist etwas sehr Direktes und Natürliches in Trumps politischer Diagnose, das sich nicht in intellektuelle Kategorien fassen lässt. Trump verkörpert seit 2015 den politischen Anführer, der als erster begonnen hat, selbstverständlich geglaubte Sichtweisen zu hinterfragen.
Zum Beispiel?
Beispielsweise, ob offene Grenzen wirklich zu neuer nationaler Stärke und weltweitem Frieden führen. Oder ob der globale Freihandel tatsächlich der US-Wirtschaft und der Wirtschaft westlicher Länder insgesamt nutzt. Und er bereitete einer Rückkehr zu klassischen und christlichen Quellen nationaler Stärke den Weg. Nur ein Beispiel: Das US-Militär hat in den vergangenen Monaten ganz viele neue Soldaten rekrutiert, da man sich von der woken Politik der Biden-Regierung verabschiedet hat.
Den Krieg zwischen Russland und der Ukraine hat Trump aber, entgegen seiner Ankündigungen, nicht in 24 Stunden beendet. Nun scheint es, als würde auch bei ihm ein gewisses Umdenken stattfinden und er mehr und mehr am Willen Wladimir Putins zweifeln, die Kampfhandlungen einstellen zu wollen. Wie schätzen Sie den bisherigen Ansatz Trumps ein?
Präsident Trump hat eine schwierige Situation geerbt. Im Wahlkampf und auch davor hat er immer wieder gesagt, dass der Krieg unter ihm als Präsident nie begonnen hätte. Ich denke, die Mehrheit der Staats- und Regierungschefs weltweit hat erkannt, dass Trump eine sehr viel glaubwürdigere Position vertritt als Biden zuvor. Die Faktoren auf Seiten des Westens haben sich unter Trump entscheidend verändert. Sein einzigartiges Verhandlungsgeschick, sein Versuch, Amerika wieder auf starke Füße zu stellen und dem Land wieder eine glaubwürdigere Stimme auf der internationalen Bühne zu verleihen, seine Fähigkeit, auf Seiten des Westens eine breite Koalition für seine Agenda zusammenzutrommeln: All das erzeugt nun große Hoffnung, dass die Kriegsparteien zu einer erfolgreichen Verhandlungslösung kommen werden. Am Ende hängt es natürlich nicht nur von Präsident Trump sondern auch von anderen internationalen Akteuren ab.
Und dennoch hat man in Europa manchmal den Eindruck, dass Trump dazu neigt, mit den „starken Männern” zu kuscheln und die Verbündeten hart ranzunehmen.
Wenn es darum geht, Trumps einzigartige Verhandlungstaktik zu verstehen, sollte man sein Buch „The Art of the Deal” lesen. Das Überraschende ist, dass seine Taktik immer noch funktioniert, obwohl jeder sie kennt. Sein Ziel ist es, die Verhandlungspartner an einem Tisch zu versammeln. Dazu wählt Trump Methoden, die Außenstehenden vielleicht kontraintuitiv erscheinen mögen. Das Ergebnis wird den Beweis liefern: Wenn er die Russen und die Ukrainer zusammen an den Verhandlungstisch bringen kann, kann man sagen, dass sein Vorgehen erfolgreich war.
Würden Sie sagen, dass Trumps Zollpolitik ein Erfolg war? Inzwischen hat man ja viele bilaterale Vereinbarungen getroffen, jüngst auch mit China. Sind wir also wieder beim „Status quo ante“?
Nein, sind wir nicht. Seit den Zollankündigungen am „Liberation Day” hat sich etwas grundlegend verändert: Bislang hat niemand darüber gesprochen, dass ausgeglichene Handelsbilanzen notwendig sind, jetzt sprechen alle darüber. Da wir in einer Welt des neuerlichen strategischen Wettbewerbs leben, ist es wichtig, dass die westlichen Mächte sicherstellen, dass sie eine ausgeglichene Wirtschaft vorweisen, und dass mehr im Inland hergestellt wird. Während des Russland-Konflikts hat man gesehen, dass die Lieferketten, die den militärisch-industriellen Komplex des Westens bedienten, sich als schwach und instabil herausgestellt haben. Grundsätzlich erleben wir eine Rückkehr der strategischen Perspektive, auf den Westen im Allgemeinen und auf die USA im Besonderen.
Was genau meinen Sie damit?
Wir stehen vor einer strategischen Herausforderung: Der Blick Amerikas wendet sich verstärkt China und der Pazifikregion zu. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen wir viel pragmatischer und weniger ideologisch agieren, wenn es darum geht, wie wir unsere Gesellschaften strukturieren. Wir können es uns nicht leisten, dass der gesellschaftliche Progressivismus unendlich weitergeht. Strategisch brauchen wir den Patriotismus, starke Familien, Gesellschaften, die nicht in sich gespalten sind, sondern zum Zweck des Gemeinwohls zusammenarbeiten. Es geht hier nicht einfach nur um ideologische Debatten zwischen einer konservativen und einer liberalen Version moderner Demokratie, sondern es handelt sich um strategische Notwendigkeiten.
Kritiker der politischen Neuausrichtung meinen, es würde einfach nur das eine radikale Extrem durch ein anderes ersetzt. Was sagen Sie denen?
Es ist ganz natürlich, dass es Gegenreaktionen auf ein Extrem gibt. Die Trump-Bewegung stellt für die meisten jedoch nur eine Rückkehr zu normalen Verhältnissen dar. Das beste Verständnis von Konservatismus besteht darin, dass dieser tatsächlich die Natur des Menschen widerspiegelt – und dessen Bedürfnis, Familien zu gründen, in Gemeinschaft zu leben, eine Vorstellung vom Guten zu teilen, den klassischen Tugenden zu folgen und eine christliche Gesellschaft zusammenzuhalten. Natürlich ist gute Regierungsführung gefragt. Aber kritische Stimmen sollten nicht denjenigen die Schuld geben, die versuchen, eine Form von Ordnung wiederherzustellen. Hoffentlich wird daraus eine ausgereiftere Vision eines modernen, erfolgreichen, freien aber doch geerdeten Westens hervorgehen.
Die Printausgabe der Tagespost vervollständigt aktuelle Nachrichten auf die-tagespost.de mit Hintergründen und Analysen.