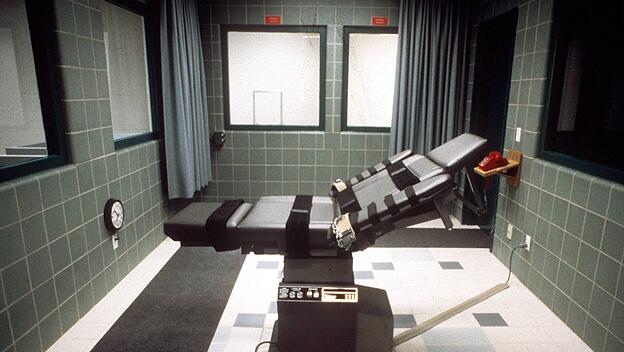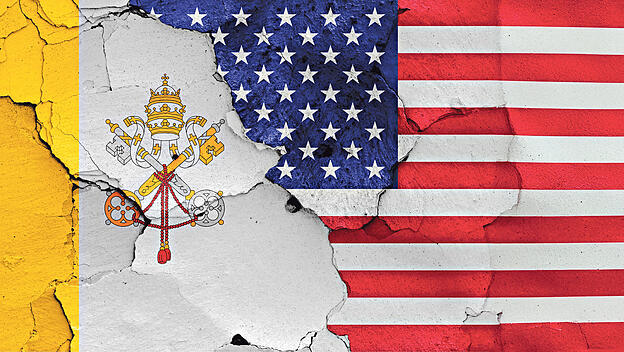Herr Hochgeschwender, Sie haben sicher die Diskussion um Pete Hegseth verfolgt, den ehemaligen Fox-News-Moderator, den Trump zum Verteidigungsminister machen will. Kritiker sehen ihn aufgrund seiner Tattoos, darunter ein Jerusalem-Kreuz und der Schriftzug „Deus vult“, als weißen christlichen Nationalisten, manche gar in der Neonazi-Szene. Wie sehen Sie das?
Das Jerusalem-Kreuz per se macht ihn nicht zum christlichen Nationalisten. Das ist ein Zeichen, das von ganz anderen Institutionen verwendet wird, beispielsweise von den Grabesrittern, und die gehören sicher nicht zum rechtsradikalen Spektrum. Mit „Deus vult“ oder „Deus lo vult“ verhält es sich etwas anders. Das ist der alte Kreuzfahrer-Ruf. Da gibt es tatsächlich Beziehungen in das Lager weißer christlicher Nationalisten – die übrigens oft Protestanten sind, was auch auf Hegseth zutrifft. Sie übernehmen da etwas aus dem Mittelalter, das – freundlich ausgedrückt – einen antiislamischen Unterton hat. Gleichzeitig kennen wir den Kontext nicht, in dem die Tattoos gestochen wurden. Man sollte sie also nicht überinterpretieren, aber mit der gebotenen Vorsicht betrachten.
Der designierte Vizepräsident J.D. Vance spricht von antichristlichen Vorurteilen im Blick auf Hegseth – trifft es das?
Generell liegt Vance da nicht falsch. Es gibt im linksliberalen US-Spektrum säkular-humanistische Strömungen, die ganz deutlich anti-christlich und vor allem anti-katholisch sind. Auf der anderen Seite ist es auch problematisch, gegenüber Hegseth' Kritikern den Vorwurf des Antichristlichen zu erheben, wenn man die Kombination der Tattoos betrachtet. Denn man muss zumindest einräumen, dass da zwei Dinge zusammengebracht werden, die man so lesen kann, wie sie von den Linken gelesen werden, auch wenn man sie nicht notwendigerweise so lesen muss. Was den Vorwurf des Antichristlichen angeht, sollte man medial sehr viel aufmerksamer sein, wenn es um Kirchenschändungen oder Schändungen katholischer Statuen geht. Denn da steckt eindeutig ein anti-katholischer und antichristlicher Zug dahinter.
Nach Trumps Wahlsieg herrschte bei einigen Theologen Bestürzung, insbesondere über das Abstimmungsverhalten der US-Katholiken. Ein Theologe warf die Frage auf, ob es im Katholizismus keine Tugendethik mehr gebe? Rechtfertigt Trumps Sieg eine derartige Frage?
Auch da würde ich sagen, man muss die Äußerung differenziert betrachten. Ich hatte sie auch gelesen. So, wie sie daherkommt, ist sie undifferenziert, da es nur darum geht, Katholiken in den USA abzuwatschen, die Trump gewählt haben. Gleichzeitig trifft der Theologe einen Punkt: Denn mit Tugend hat Trump ja tatsächlich nichts zu tun. Überspitzt formuliert ist er ein ehr- und charakterloser Lump, der zudem einen Putschversuch gestartet hat. Wieviel muss man sich also zurechtbiegen, um ihn als guten Präsidenten zu sehen? Ich weise auch darauf hin, dass nicht nur bei Thomas von Aquin, sondern auch bei Kant die Lüge „intrinsece malum“ ist. Also ein Böses in sich. Bei Thomas von Aquin gibt es keinen Grund, eine Lüge zu rechtfertigen.
Nun lügt Trump ja andauernd.
Eben. Insofern ist die Frage nach der Tugendethik berechtigt: Man kann nicht die Pro-Life-Position hochhalten, die bei Trump nur oberflächlichen Charakter hat, wie man in diesem Wahlkampf gesehen hat, und gleichzeitig die Tugendethik komplett vergessen, die in der Grundlage jeder katholischen Ethik steckt. Auch da empfehle ich die Lektüre des heiligen Thomas, der sich sehr breit über Tugendethik auslässt. Hinzukommt, dass auch die Soziallehre zu den Grundlagen des Katholischen gehört. Man darf bestimmte Punkte nicht isolieren, man darf sie nicht gegeneinander ausspielen, wie das zum Teil von linken Theologen getan wird. Nur weil jemand die Tugendethik und die katholische Soziallehre vernachlässigt, darf man nicht so tun, als sei dessen Position in der Abtreibungsfrage wertlos.
Für viele konservative Katholiken war die Abtreibungsfrage sozusagen das „Totschlagargument“, um jemanden wie Kamala Harris nicht zu wählen.
Das Problem liegt darin, dass wir auf katholischer Seite in den letzten Jahrzehnten, schon seit Johannes Paul II., alles stark an der Abtreibungsfrage festmachen. Das ist ja einerseits korrekt, denn es handelt sich um eine Frage, bei der es im wahrsten Sinne des Wortes um Leben und Tod geht. Aber sie steht in einem breiteren Kontext, zu dem auch die Tugendethik und die katholische Soziallehre gehören. Man kann nicht so tun, als seien sie nicht Bestandteile des Katholischen. Heutige konservative Katholiken neigen dazu, dem Lehramt die Berechtigung abzusprechen, überhaupt soziale Äußerungen zu tätigen. Das ist ein alter Konfliktpunkt zwischen der Minderheit der Paläokonservativen und den neuen Konservativen. Die Paläokonservativen haben immer am Primat des Lehramtes festgehalten, auch am Recht und an der Pflicht des Lehramtes, sich zu sozialen Fragen zu äußern. Während die neueren Konservativen, und zu ihnen würde ich auch J.D. Vance zählen, sehr oft libertär und neoliberal denken. Da sehe ich wenig Überschneidungen mit einer genuin katholischen Soziallehre.
Der US-Theologe Massimo Faggioli warf Vance „eine Mischung aus Nationalismus, Libertarismus und Technokratie“ vor, damit stehe er im Widerspruch zur katholischen Lehre. Sehen Sie das so?
Auch da muss man differenzieren. Ich würde Vance nie seinen katholischen Glauben absprechen. Sein Konversionsprozess geschah ja nicht von heute auf morgen und hatte auch wenig mit Wahlen oder Politik zu tun. Er hat sich sehr intensiv mit dem heiligen Augustinus auseinandergesetzt und über ihn den Weg in die katholische Kirche gefunden. Vance' Buch „Hillbilly Elegy“, das er vor seiner Konversion geschrieben hat, ist dagegen ein neoliberales, teilweise auch libertäres Buch. Es ist die Aufstiegsgeschichte eines Einzelnen, der sich im Kampf ums Dasein durchsetzt. Ich habe nie verstanden, warum das Buch in Deutschland so positiv rezensiert worden ist. Ich fand es damals sehr problematisch, gerade vom katholischen Standpunkt aus. Mit dem Nationalismus wiederum ist es so eine Sache. Katholiken haben selbstverständlich ein Recht darauf, Patrioten zu sein. Man muss das allerdings mit dem katholischen Universalismus, der ja schon im Wort „katholisch“ steckt, in Kontext setzen. Es darf keine absolute Überordnung der Nation, also so etwas wie „America first“, oder „America only“ geben – das wäre unkatholisch.
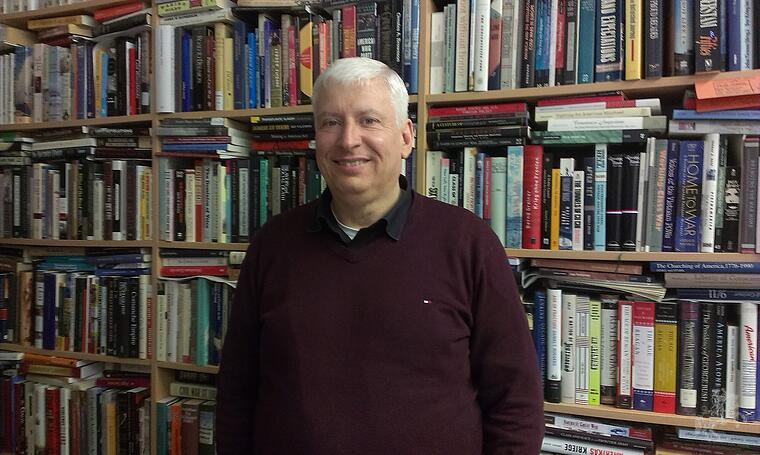
Was wäre noch im Rahmen des Katholischen?
Eine patriotische Hingabe an die Nation ist durchaus akzeptabel. Was mir bei J.D. Vance vor allem zu denken gibt, ist sein Verhältnis zum Silicon-Valley-Investor Peter Thiel. Der ist Atheist, obwohl er Vance damals auf den heiligen Augustinus gebracht hat. Thiel ist radikal libertär. Und der Libertarismus ist eine in sich anti-katholische Ideologie. Zudem hat Thiel eine Nähe zu autoritär-ständestaatlichen Staatsmodellen. Das Silicon Valley hat generell eine Affinität für den technologischen Post- und Transhumanismus, der gleichfalls dem katholischen Menschenbild widerspricht.
Weshalb ist der Libertarismus anti-katholisch?
Der personale Charakter des Menschen, auf dem die Menschenwürde beruht, wird hier zugunsten eines radikalen Individualismus geleugnet. Und das ist in sich unkatholisch. Man darf zudem nicht vergessen, dass die Begründerin des Libertarismus, Ayn Rand, eine strikte Befürworterin von Abtreibung war. Was nicht ins Weltbild passt, wird dann aber oft ausgeblendet.
Das Katholische scheint derzeit eine große Anziehungskraft auf einige bekannte Persönlichkeiten auszuüben. Vance ist nur einer von zahlreichen prominenten Konvertiten. Warum hat die Inanspruchnahme des Attributes „katholisch“ plötzlich eine positive politische Wirkung?
Weil im Katholischen immer auch die Möglichkeit einer Kritik der Moderne steckt. Das heißt nicht, dass man gleich antimodern ist. Aber das Katholische bietet einen Gegenpol zur Gleichsetzung von Moderne mit Liberalismus und Aufklärung, die ja in sich schon problematisch ist. Ich empfehle immer die Lektüre des liberalen Philosophen Isaiah Berlin, der nachgewiesen hat, dass die Moderne aus der Dialektik von Aufklärung und Gegenaufklärung entsteht. Die Gegenaufklärung ist also ein integraler Bestandteil der Moderne. Die Moderne ist nicht einfach liberal. Der Katholizismus bietet eine intellektuelle Möglichkeit, sich damit kritisch auseinanderzusetzen. Ein anderer Aspekt ist die Anziehungskraft der Liturgie. Es muss nicht notwendigerweise die tridentinische Messe sein, es kann auch eine gut gestaltete vatikanische Liturgie sein. Aber eine Liturgie, die den Geheimnischarakter des Göttlichen deutlich macht, in der es nicht nur um Worte geht, sondern auch um eine tiefe, innerliche Beziehung zu Gott im Ritus. Auch das bietet das Katholische. Es mag bei manchen Konservativen auch die Idee der Autorität des Papsttums und des kirchlichen Lehramts Anklang finden, die eine Schutzmauer bietet gegen die Verwerfungen einer gar zu liberal gewordenen Moderne.
Die Anziehungskraft des Katholischen liegt demnach spirituell an der Faszination für die Liturgie, und politisch an der Suche nach einem intellektuellen Überbau für die eigene Weltanschauung?
Genau. Und ergänzend noch an der Erkenntnis, dass Liturgie und Ritus zum menschlichen Leben dazugehören. Das hat man in Deutschland nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil arg vernachlässigt. Man muss sich nur die Erkenntnisse der Ethnologie und der Anthropologie anschauen: Der Mensch ist auch ein rituelles Wesen. Man darf Religion, so sehr ich religiösen Intellektualismus schätze, nicht total verkopfen. Religion ist etwas, was den ganzen Menschen angeht. Sie muss das Gefühl und den Verstand ansprechen, also den Menschen als leib-seelische Ganzheit. Da gehört der Ritus einfach mit dazu.
Dann wenden wir uns nochmals den harten politischen Fakten zu: US-Katholiken stimmten mit sehr viel deutlicherem Abstand als sonst für Trump, von der sonst zitierten Spaltung in zwei gleich große Lager war nichts zu sehen. Ein Zeichen für eine dauerhafte Neuausrichtung dieser Wählergruppe?
Zunächst hat man gesehen, dass die Religion für die Wahlentscheidung kaum eine Rolle spielte. Entscheidend waren Ökonomie, Inflation, Abstiegsängste, Migration. Das sind alles Themen, die mit Religion selbst wenig zu tun haben. Hinzukommt, dass Kamala Harris einen extrem schlechten Wahlkampf geführt hat, ob das jetzt an der kurzen Zeit lag, die sie hatte, oder an ihr selbst, sei dahingestellt. Wir werden bei den Zwischenwahlen in zwei Jahren sehen, wie dauerhaft dieser Trend unter US-Katholiken ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich plötzlich innerhalb des Katholizismus langfristig so eine massive Verschiebung zugunsten der Republikaner vollzogen hat.
Die Printausgabe der Tagespost vervollständigt aktuelle Nachrichten auf die-tagespost.de mit Hintergründen und Analysen.