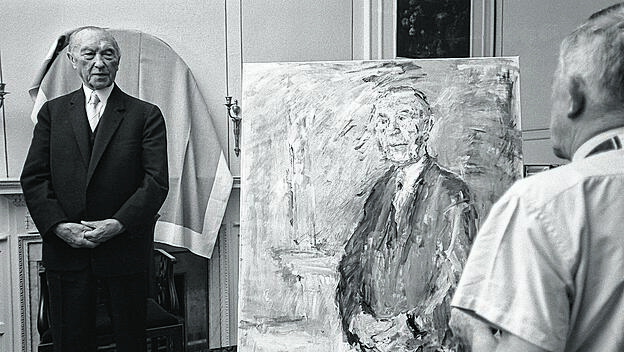Am 29. und 31. Januar 2025 haben die Unionsparteien sich im Deutschen Bundestag aus den Fesseln eines Antifaschismus befreit, der zu einem Instrument der Machtabsicherung verkommen ist. Der Preis für diesen Schritt ist noch nicht abzusehen – doch zugleich war er erforderlich, weil die Alternative darin bestand, die Politik von SPD und Grünen weiter zu unterstützen, die in den letzten drei Jahren zu einer Verdopplung der AfD-Umfrageergebnisse geführt hat. Für den Erfolg des Kurswechsels der Unionsparteien wird es nun entscheidend sein, dass er gut erläutert wird. Dafür ist es unabdingbar, aufzudecken, wie SPD und Grüne den Kampf gegen Rechtsextremismus – der gerade im Umfeld ihrer Parteien mit dem Konzept des Antifaschismus verbunden wird – benutzen, um ihre Diskurshoheit zu sichern.
Antifaschismus ist zunächst ein Anliegen, das für jeden Bürger der Bundesrepublik vor dem Hintergrund der Verbrechen des Nationalsozialismus eine Selbstverständlichkeit sein sollte – geht es doch darum, aus diesen Verbrechen die Lehre des „Nie wieder!“ zu ziehen, die die Grundlage unserer Verfassung und der politischen Kultur unseres Landes ist. Dies entspricht im Kern dem Verständnis, dass die ersten Antifaschisten, nämlich die Gegner der autoritären, ultranationalistischen Herrschaft von Mussolini in Italien, von ihrem Anliegen hatten. Zu diesen Gegnern zählten nicht nur Kommunisten, die die eine Diktatur durch eine andere ersetzen wollten, sondern auch Konservative, Liberale und Sozialdemokraten, deren Anliegen die Wiedereinführung eines demokratischen Verfassungsstaates war.
Eine Umdeutung im Sinne Stalins
Schon bald jedoch erfolgte eine ideologische Umdeutung und eine strategische Nutzung des Konzepts des Antifaschismus. Am deutlichsten zeigte sich dies bei einer internationalen Konferenz der kommunistischen Parteien unter der Führung von Stalins KPdSU, dem Komintern-Kongress 1935. Hier wurde auf der ideologischen Ebene festgestellt, dass es im Antifaschismus nicht allein um den Kampf gegen den (italienischen und spanischen) Faschismus und den (deutschen) Nationalsozialismus ging, sondern dass der Faschismus das Ergebnis eines repressiv gewordenen Kapitalismus sei – dass somit der Kampf gegen den Faschismus nur einen Teil des Klassenkampfes gegen den Kapitalismus darstellt. Auf der strategischen Ebene erklärte man den Antifaschismus zum gemeinsamen Anliegen aller linken Kräfte, die sich in diesem Kampf zu einer Volksfront zusammenschließen sollten (freilich unter der Führung der Sowjetunion).
Diese Umdeutung des Antifaschismus spielte nach 1945 in der Sowjetischen Besatzungszone (SBZ) und ab 1949 in der DDR eine zentrale Rolle. Der so, im Sinne Stalins, verstandene Antifaschismus wurde zum Gründungsmythos der DDR. In der Bundesrepublik gewann der Antifaschismus in seinen zwei Bedeutungen hingegen erst in der Studentenbewegung eine größere Rolle. Zahlreiche Studenten forderten berechtigterweise und aus Überzeugung die umfassende Aufarbeitung der Verbrechen des Nationalsozialismus. Die linksextremistischen Kräfte in der Studentenbewegung übernahmen die Forderung nach einer Aufarbeitung, verfolgten aber damit eine andere Agenda: Ihnen ging es um die Delegitimierung des gesamten politischen Systems der Bundesrepublik als mindestens latent „faschistisch“; als Begründung wurde u.a. auf ehemalige Nationalsozialisten in Politik und Behörden sowie auf repressive staatliche Maßnahmen hingewiesen. Die ideologische Umdeutung des Antifaschismus war wiederum mit einem strategischen Anliegen verbunden: Das Konzept wurde zu einem Narrativ, mit dem zum einen Gräben zwischen linksextremistischen Gruppierungen untereinander überwunden wurden und zum anderen eine Brücke zu Demokraten geschlagen werden konnte. Antifaschisten wollen schließlich alle sein und Linksextremisten merkten bald, dass sie mit diesem Anliegen eine hohe gesellschaftliche Akzeptanz generieren konnten.
„Rechts“, ein bewusst offener Begriff
Mit dem Aufstieg der AfD fanden beide Deutungen des Antifaschismus ihren Weg in die Parteipolitik und in die Parlamente. Dabei lassen sich diejenigen, denen es beim Engagement gegen Rechtsextremismus um den Schutz der freiheitlich-demokratischen Grundordnung geht, daran erkennen, dass sie sich gegen jede Form der extremistischen Ablehnung unserer Verfassung wenden – inklusive des Linksextremismus, und auch, wenn dieser im Gewand des Antifaschismus erscheint. In der aktuellen Debatte lässt sich ein überzeugter Verfechter der Grundwerte unserer Verfassung insbesondere auch daran erkennen, dass er die sofortige Beendigung der Drohungen und tätlichen Angriffe gegen CDU-Politiker und -Parteibüros fordert.

Führende Politiker von SPD und Grünen lassen jedoch die Äquidistanz zu verschiedenen Formen des politischen Extremismus vermissen. Für sie ist eine starke AfD gerade vor dem Hintergrund der eigenen niedrigen Umfragewerte ein Machtinstrument zur Sicherung der Diskurshoheit: Ideologisch dient sie ihnen zur Diffamierung abweichender Positionen als „rechts“. Dabei ist „rechts“ ein bewusst offener Begriff, der zumindest eine Nähe zur AfD unterstellt – vulgo: zum „Faschismus“. Strategisch geht es dabei um die Verhinderung eines Politikwechsels, denn SPD und Grüne nötigen die Unionsparteien zu Absprachen und Koalitionen, die diese nur um den Preis verhindern können, als Kollaborateure der „Faschisten“ zu erscheinen – und das, obwohl gerade diese Art von Politik die angeblichen „Faschisten“ immer stärker werden ließ.
„Tor zur Hölle“ oder legitimer Pragmatismus
Dabei ist anzumerken, dass die Unionsparteien am 29. und 31. Januar dezidiert nicht mit der AfD zusammengearbeitet haben, sondern nur in Kauf genommen haben, dass die AfD-Abgeordneten für ihre Anträge stimmen. Gleiches haben auch SPD und Grüne schon mehrfach getan, wie folgende Beispiele zeigen: Auf kommunaler Ebene hat die SPD schon mehrfach gemeinsam mit der AfD abgestimmt, so erst jüngst bei der Kürzung des Sozialticket-Zuschusses in Fürth Anfang November. Auch im Bundestag kam es zum Schulterschluss von SPD und Grünen mit der AfD-Bundestagsfraktion, als diese Ende Januar die Beschlussunfähigkeit des Bundestages bei der Abstimmung zu den Ukrainehilfen erfolgreich bezweifelte – dies kam den Regierungsparteien wegen ihres koalitionsinternen Dissenses gerade recht. Und schließlich hat Bundeskanzler Scholz höchstpersönlich in einem Interview mit der Thüringer Allgemeinen im Sommer 2023 betont, dass es keine Zusammenarbeit sei, wenn die AfD einem Vorschlag der SPD zustimme. Kurzum: Im Kampf gegen den „Faschismus“ wird mit zweierlei Maß gemessen: Was bei SPD und Grünen legitimer Pragmatismus ist, wird als Aufstoßen des „Tors zur Hölle“ (Mützenich) gedeutet, wenn es die Unionsparteien tun. Einen besseren Beleg könnten die beiden Parteien kaum liefern, dass ihr Engagement „gegen rechts“ eine Strategie des Machterhalts ist.
Teil der Strategie des Antifaschismus ist es, den Begriff des Faschismus gezielt zu vernebeln. Neonationalsozialistische Positionen finden sich im gegenwärtigen Rechtsextremismus durchaus, auch in der AfD, die eine sehr heterogene Partei ist (vgl. die AfD-Mitglieder unter den im November festgenommenen „Sächsischen Separatisten“) – doch sie spielen in der Partei eine völlig untergeordnete Rolle. Die rechtsextremistischen Kräfte in der AfD zeichnen sich insbesondere durch Fremdenfeindlichkeit aus, wie sie in pauschalen Forderungen nach einer „Remigration“ ganzer Gruppen von Migranten zum Ausdruck kommt. Zudem zeigen sie immer wieder eine offene Verachtung der parlamentarischen Demokratie (so z.B. in der konstituierenden Sitzung des Thüringer Landtags am 26. September 2024). Auch die Nähe zu Russland stellt eine Gefahr dar, weil dadurch Staatsgeheimnisse in den Händen von AfD-Politikern unmittelbar ihren Weg nach Moskau und Peking finden können.
Es gibt also gute Gründe für die Unionsparteien, mit einer AfD, in der die rechtsextremistischen Kräfte seit Jahren ein immer stärkeres Gewicht bekommen, keine Absprachen anzustreben. Doch wer die AfD als „Nazis“ bezeichnet und Unionspolitikern die Zusammenarbeit mit solchen unterstellt, hat nicht nur den politischen und moralischen Maßstab verloren, sondern instrumentalisiert die Erinnerung an die Verbrechen des Nationalsozialismus.
Hendrik Hansen ist Professor für politischen Extremismus und politische Ideengeschichte an der Hochschule des Bundes für öffentliche Verwaltung.
Die Printausgabe der Tagespost vervollständigt aktuelle Nachrichten auf die-tagespost.de mit Hintergründen und Analysen.