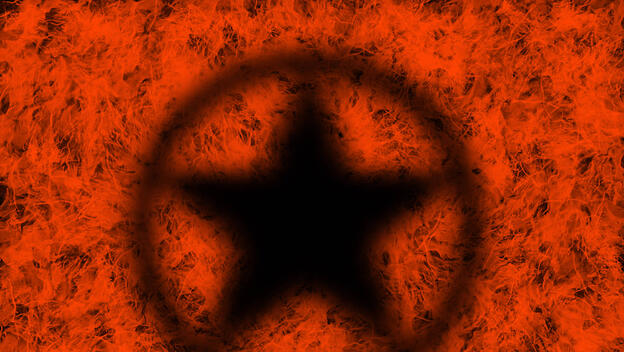Die ganze Welt ein Tinnitus!" Ingrid Caven intoniert dieses Bonmot wie den Vers eines Chansons. Auftaktig beginnt sie und frappiert mit einem kraftvoll verblüffenden Wort. Auch Volkslieder beginnen mit dem harmlosen Jambus und entwickeln doch eine Tiefe, die oft mehr über den Zustand der Welt aussagen als abstrakte philosophische Abhandlungen. Caven strafft den Rücken und lauscht noch ein bisschen genauer hinein in das Weltenchaos. Nicht ohne ein Schmunzeln freilich, denn das Überdimensionale, menschliche Größe Überschreitende ist ihre Sache nicht. In einer Welt, die ein Gedankengebäude gegen das andere ausspielt, verliert sich der Sinn für das Maß. Zwischen Scylla und Charybdis bewegen sich die Kämpfe: Entweder geht es um alles oder eine Unzahl von Nichtigkeiten, die zum vorgeblichen Heil der Menschheit ins Gefecht geführt werden. In diesen Gefilden trumpft entweder die Hybris oder eine heuchlerische Demut, die auch nichts anderes ist als camouflierte Dünkelhaftigkeit.
„Etwas Sakrales durchströmt die Musik, unterschwellig vielleicht,
aber spürbar für alle, die den Menschen in einem Weltenakkord verorten“
Selten sind Menschen, die sich nicht verschlingen lassen von Größenwahn oder Nachlässigkeit. Ingrid Caven ist von dieser Sorte: Das Andere, das Großartige sei zu groß für sie, sagt sie und setzt sich selbst den Rahmen für ihr Singen und Handeln. Der 1938 in Saarbrücken als Tochter eines Tabakhändlers geborenen Sängerin und Schauspielerin haftet der Ruf der letzten deutschen Diva an, doch fremdelt La Caven, geborene Schmidt, mit diesem Etikett. Als Deutsche sei sie, wohlgleich seit langem Pariserin, aufgewachsen. Ihre raue, ganz und gar nicht manierierte Eleganz habe sie in einer Heimat herausgebildet, in der das Rauschen der Hüttenwerke neben dem musikalischen Klang des bürgerlichen Elternhauses Bestand hatte. Dieser Spannungsbogen zwischen den Welten durchzieht ihr ganzes Leben. Caven studierte Kunstgeschichte, Germanistik und Pädagogik. Ein schöngeistiger Weg mit einer ordentlichen Prise Pragmatismus deutete sich an. Dann aber entdeckt sie Rainer Werner Fassbinder, das Enfant Terrible der deutschen Theaterlandschaft. Caven wird in mehr als zwanzig seiner Filme mitspielen und Fassbinder sogar ehelichen.
Allen Differenzen zum Trotz entwickelte sich eine Liebe, die Geschlechtlichkeit überschritt. Liebe war für das Paar ein Experiment. Mit Kitsch als Ersatz für Liebe hat sie sich nie beschieden. Eine Liebe wollten sie ausprobieren außerhalb der gängigen Rollensysteme, eine "großzügige Liebe". Es ist daher nicht verwunderlich, dass Caven etwas spürt, das vielen verlustig gegangen ist, etwas, das nur selten in Momenten der Liebe und der Musik, in göttlichen Augenblicken erkennbar wird: die Seele. Es ist geradezu ein Wagnis heute, dieses Wort auszusprechen. Man läuft Gefahr, als Seelchen belächelt oder mit Esoterikern aller Couleur in Verbindung gebracht zu werden. Mit diesem wabernden, diffusen, kleinlichen Seelenbegriff hat Cavens Idee jedoch nicht im Geringsten etwas gemein. Die Seele ist ihr Sensorium, der Taktgeber ihres Lebens: "Mein Körper ist oft in Aufruhr, mein Geist ändert seine Meinungen, meine Seele ist zuverlässig." Diese Seele weiß sie zu beschreiben, wenn auch nicht gänzlich zu erfassen. Das bleibende nicht greifbare Etwas aber beunruhigt sie nicht. Sie hat keine Angst vor dem Mysterium. Mit Atem und Körperlichkeit habe diese Seele zu tun. Inspiriert ist dieser Seelenbegriff von Kleist: Die Form müsse so gestaltet werden, dass die Seele ungehindert durchscheinen und weiterwandern könne. Nicht zuletzt deshalb ist ihr Formgebung als Künstlerin und Mensch so bedeutsam.
Die Kindheit hat Caven stark geprägt
Dem Unerklärlichen und Unbeherrschten begegnet sie mit einem ungebrochenen Willen zur Form. Dieses Tool, wie man heute in einem schnöden technizistischen Neusprech sagen würde, hat seinen Ursprung in Cavens Kindheit. Als kleines Mädchen litt sie unter starken Allergien und Asthmaanfällen. Diese Zeit war eine physische und psychische Prüfung für sie, in der sich Aufgeben und Kämpfen im Widerstreit befanden. Den monströsen Körper und den Schmerz zu ertragen, erforderte eine Selbstdisziplin, die einen ausgeprägten Gestaltungs- und Wandlungswillen einschloss. Den Schmerz zulassen, um ihn zu formen, transformieren und in einer künstlerischen Wahrheit aufzuheben! Dieses Verhältnis zum Schmerzkörper ist dem Katholizismus nicht fremd.
Caven ist schließlich aufgewachsen in einer katholischen Familie und spielte als Kind sogar Orgel in der Kirche in Saarbrücken. Als katholisch würde sie sich heute nicht mehr bezeichnen, eine Art Religiosität werde ihr aber immer wieder nachgesagt in ihrer Musik. Das ist nicht verwunderlich, denn auch Caven transzendiert eine weltliche Zerrissenheit, wenn sie in Albert Serras "Libertè", einem Stück über die Freiheit, Mozarts "Ave verum", einer in der Eucharistie gesungenen Motette, mit elektronischer Musik verbindet. Die Transsubstantiation musikalisch zu deuten, gelingt einem vermutlich nur, wenn einem noch "ein Schauer über den Rücken läuft" beim Gedanken des Eintritts von Christi Körper in die Hostie. Die Reibung an und die Abgrenzung von der Religion erzeugt so einen paradoxalen Effekt: Etwas Sakrales durchströmt die Musik, unterschwellig vielleicht, aber spürbar für alle, die den Menschen in einem Weltenakkord verorten.
Religion ist eine Chance
"Ich bin der Welt abhanden gekommen ... Ich bin gestorben dem Weltgetümmel und ruh in einem stillen Gebiet" heißt es in Friedrich Rückerts Lied. Gegen diese Weltverlorenheit hilft nach Ingrid Caven Struktur und damit auch Religion, denn Religion ist Form und Struktur plus eine gute Portion Sinnlichkeit. In einer orientierungslosen Zeit, in der junge Menschen in den Mäandern des Internets umherschlingern, ist Religion eine Chance, Halt zu gewinnen. Caven gesteht sich ein, dass sie sich vor zwanzig Jahren skeptischer gegenüber der Religion geäußert habe: "Heute ist es vielleicht gut, denke ich manchmal, dass die Leute wenigstens irgendeine Form geboten bekommen, in der sie sich bewegen können. Auch mit gewissen Gesetzen und Vorschriften. Das denke ich heute. ... Es ist wahrscheinlich heute besser als dieses ozeanische, weltweite n'importe quoi."
Mit protestantischer Austerität hat dieses Strukturbewusstsein allerdings beileibe nichts zu tun. Dafür duftet der Katholizismus zu sehr nach Weihrauch und lässt mit der Mutter Gottes eine Wärme und Herzensgüte einströmen, die den Appell nach Form und Disziplin wohltuend temperieren.
Diese Verbindung aus Form und Sinnlichkeit kommt auch in Roswitha Heckes berühmtem Porträt von Ingrid Caven zum Ausdruck. Die Schweizer Fotografin lichtete Caven mit dramatisch geschminkten Augen und Zigarette unter einer Marienfigur mit Jesuskind ab. Caven schmiegt sich nahezu an diese Mutter Gottes oder steht ihr zumindest schwesterlich zur Seite, eingehüllt in einen Pelz, das Haar onduliert, die dunklen Augen durch die smokey eyes noch unergründlicher, sehnsuchtsvoll auf etwas hinblickend. Der Blick Mariens dagegen strebt himmelwärts. Doppelung oder Antipoden?
Ohne Glauben muss man sich an die weltliche Liebe halten
Weder das Gegensätzliche noch das Ähnliche genügen diesem Bild. Es ist eine Art Anverwandlung, eine Überblendung, die sich offenbart. Erstaunlich ist das nicht, denn Caven war "völlig abgefahren auf die Maria" als Kind. Beide Frauen sind mit sich im Reinen und lassen doch Raum für Deutung und Geheimnis. Man machte es sich zu leicht, dieses Bild im Kontext einer feministischen Ikonographie zu interpretieren. Die Vielfalt weiblicher Lebensentwürfe. Mutterschaft und Selbstverwirklichung. Reinheit und Sünde. Gerecht würde man damit weder Maria noch Caven, denn beiden ist eine Entrücktheit gemein, eine Zeitlosigkeit, vielleicht auch ein Anachronismus, der Provokation und Halt zugleich ist. Unzeitgemäß und doch resolut modern ist auch das Frauenbild, das Caven vertritt. Von der Apologie der "starken Frau" hält sie nichts. Nein, nein, nein! Um Gottes Willen! Lebendig sein wolle sie. Und was belebt uns mehr als die Liebe zu Gott und der Welt?
Es verheißt Trost in diesem Chaos, wenn Caven sinniert: "Im Glauben kann man lange hausen. Wenn man das nicht mehr hat, wird's brenzlig. Dann ist es gut, wenn man jemanden lieben kann."
Aktuell ist von Ingrid Caven und Ute Cohen im Kampa Verlag erschienen:
Ingrid Caven: Chaos? Hinhören, Singen. Ein Gespräch mit Ute Cohen. 176 Seiten, EUR 20.
Die Printausgabe der Tagespost vervollständigt aktuelle Nachrichten auf die-tagespost.de mit Hintergründen und Analysen.