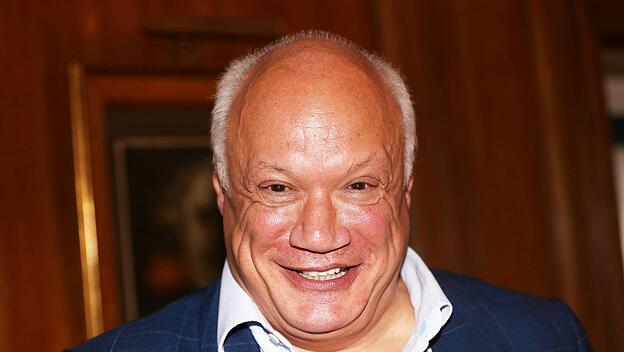Auf der christlichen Webseite Mercatornet beschreibt Jonathon Van Maren anhand der Aussagen von Repräsentanten des intellektuellen Atheismus die zunehmende Tendenz, wie sich bei ihnen die Erkenntnis nach der großen Bedeutung christlicher Werte durchsetzt, die diese auch heute noch für die modernen Gesellschaften haben.
Im Kampf
So habe etwa der verstorbene Sir Roger Scruton angefangen, von selbst die Kirche zu besuchen und regelmäßig die Orgel in der All Saints Kirche im britischen Garsdon zu spielen, obwohl er mit dem Glauben im Kampf lag: „Seine weltlichen Freunde sagen, sein Glaube sei ein kultureller Glaube geblieben – doch andere Freunde waren da nicht so sicher. Was wir jedoch wissen, ist, dass er meinte, das Christentum sei in vielerlei Hinsicht die Seele der westlichen Zivilisation, und dass für ihr Überleben das einzigartige christliche Konzept von der Vergebung absolut unverzichtbar sei“.
Unbequeme Agnostiker
Scrutons Freund, der christlich aufgewachsene konservative Journalist und Autor Douglas Murray, der die Kirche als Erwachsener verließ, bezeichnet sich gelegentlich als „christlichen Atheisten“. In einem Interview mit dem Theologen N. T. Wright beschrieb er sich kürzlich selbst als „unbequemen Agnostiker, der die Tugenden und Werte anerkennt, die der christliche Glaube mit sich gebracht hat“. Darüber hinaus bemerkte er in diesem Gespräch, „dass er tatsächlich irritiert sei, wie die Kirche von England [die anglikanische Kirche] vor ihrem Erbe flüchtet, wie sie im Austausch für progressives Erbarmen auf ‚ihre Juwelen verzichtet‘ - wie die King James Bibel und das Gebetbuch der anglikanischen Kirche“. Murray befürchte, so sagte er, „dass die Kirche nicht das tut, was so viele von uns außerhalb von ihr möchten, dass sie tut – nämlich das Evangelium zu predigen und seinen Wahrheiten und Forderungen Geltung zu verschaffen“. Wenn man sehe, wie sie sich ständig den neuesten Trends anpasse, denke man sich: „Nun gut, da verschwindet wieder etwas, wie eben absolut alles andere in dieser Zeit“. Er sei daher ein „enttäuschter Nicht-Anhänger“.
Unverzichtbares Christentum
Murray glaube, das Christentum sei unverzichtbar, weil die Anhänger einer säkularen Denkweise sich als total unfähig erwiesen hätten, eine Ethik der Gleichheit zu entwerfen, die mit dem Konzept übereinstimme, dass alle Menschen nach dem Bilde Gottes erschaffen sind. In einem Pressebeitrag habe er einmal bemerkt, dass die postchristliche Gesellschaft drei Optionen habe. Die erste bestehe darin, die Vorstellung aufzugeben, alles menschliche Leben sei wertvoll. Eine weitere Option sei, „sich auf eine atheistische Version der Unverletzlichkeit des Individuums festzulegen“, wie Murray schreibt. Und wenn das nicht funktioniert? Dann, so der Autor von „Der Wahnsinn der Massen“ weiter, „gebe es nur noch eine weitere Anlaufstelle: Zurück zum Glauben, ob wir es wollen oder nicht“. In einem kürzlich veröffentlichten Podcast wurde er noch deutlicher: „Die Unverletzlichkeit des menschlichen Lebens ist eine jüdisch-christliche Vorstellung, die [das Verschwinden der] die jüdisch-christliche Zivilisation ganz einfach nicht überstehen kann“.
Der Politikwissenschaftler und Agnostiker, Charles Murray, sagte in einem Interview für Mercatornet, er glaube, dass die amerikanische Republik ohne eine Renaissance des Christentums vermutlich nicht weiterexistieren werde. Die Verfassung der Vereinigten Staaten und die Freiheiten, die sie verteidige, könne nur ein religiöses Volk leiten.
Christentum verändert
Ähnlich argumentiere auch der Historiker Tom Holland, dessen neuestes Werk „Herrschaft: Die Entstehung des Westens“ gerade auf Deutsch erschienen ist. Jahrelang schrieb Holland – ein Agnostiker – „überzeugende historische Darstellungen über die alten Griechen und Römer, doch er hatte beobachtet, dass es in ihren Gesellschaften gesellschaftlich akzeptierte Grausamkeiten gegenüber Schwachen gab – Vergewaltigung und sexueller Missbrauch der riesigen Sklavenklasse als unhinterfragter Lebensstil sowie die Massenvernichtung von Feinden als Selbstverständlichkeit. Diese Völker und ihre Ethiken, so schreibt Holland, schienen ihm vollkommen fremd“. Es sei das Christentum gewesen, so folgerte Holland, dass all dies mit einer so totalen Revolution verändert habe, so dass selbst Kritiker des Christentums Prinzipien von ihm übernehmen mussten.
So sei es faszinierend zu sehen, schließt der Artikel von Van Maren, wie Intellektuelle zunehmend auf den christlichen Glauben zugehen – „sie glauben nicht, aber irgendwie wollen sie glauben. Der Psychologe Jordan Peterson, der häufig über das Christentum spricht, ist dafür ein gutes Beispiel. In einem Gespräch über die Historizität der christlichen Geschichte sagte er, mit Tränen kämpfend: ‚Wahrscheinlich glaube ich das, aber ich bin überrascht über meinen Glauben und ich verstehe das nicht‘“. DT/ks
Die Printausgabe der Tagespost vervollständigt aktuelle Nachrichten auf die-tagespost.de mit Hintergründen und Analysen.