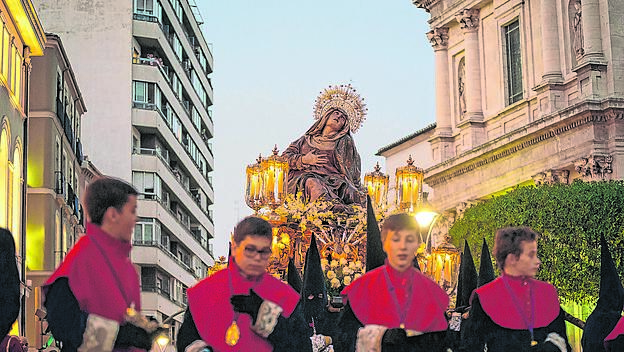Hochtrabend und dunkel kommt der Titel des neuen Buches von Jordan Peterson daher: „Die Essenz des Seins“. Hat der Psychologe und Bestsellerautor („12 Rules For Life: Ordnung und Struktur in einer chaotischen Welt“) etwa eine metaphysische Abhandlung vorgelegt? Wer das dünne Büchlein aufschlägt, merkt jedoch schnell, dass es in Wahrheit nicht um Sein und Wesen, sondern um die Frage der Identität geht – und das gleich zweimal. Denn in diesem Band versammelt sind zwei Texte, die im Rahmen der von Peterson ins Leben gerufenen „Alliance for Responsible Citizenship“-Konferenz 2023 entstanden sind: einmal ein Essay Petersons mit dem Titel „Die Essenz der Identität“ und einmal das Gemeinschaftswerk „Identität: Das Individuum und der Staat gegen die subsidiäre Hierarchie des Himmels“, das Peterson gemeinsam mit seinem kanadischen Landsmann Jonathan Pageau, einem Ikonenschnitzer und Symbolforscher, verfasst hat.
Wer sich schon einmal Vorträge von Peterson angehört hat, weiß in der Regel nicht nur, wie eloquent er sein kann, sondern auch wie luftig und wenig substanziell manche metapherngeladene Formulierung wirkt, wenn man über sie nachdenkt. Das gilt nicht zuletzt, wenn es um Religion und Gott geht. Der Atheist Sam Harris brachte in einer Diskussion mit Peterson einmal seine Frustration darüber zum Ausdruck, dass er am Ende all ihrer Gespräche immer noch nicht wisse, woran Peterson eigentlich glaube. Auch bei der Lektüre der beiden Texte von „Die Essenz des Seins“ gibt es solche Momente, zum Beispiel wenn Peterson im abgeschmackten Pastoralsprech verkündet, beim Glauben handele „es sich um die Art von Mut, die es einem erlaubt, die Möglichkeiten der Zukunft mit offenen Armen zu empfangen“. Erfreulicherweise sind derartige Pseudo-Tiefsinnigkeiten recht selten. Stattdessen bietet Peterson, sowohl allein als auch im Duo mit Pageau, seinen Lesern eine durchaus lesenswerte Theorie der menschlichen Identität.
Ohne Verantwortung keine Identität
Im Zentrum steht die Frage, wie der Mensch eine stabile Identität ausbilden kann, die sein Leben insbesondere für die Dimension des Sinns öffnet. Petersons einfache und dem gesunden Menschenverstand unmittelbar einleuchtende These lautet, dass es Identität nicht ohne die Übernahme von Verantwortung gibt. Und Verantwortung zu übernehmen heißt, innerhalb eines hierarchischen Gefüges „seine angemessene Rolle … einzunehmen“ und dadurch den Blick über das eigene Ich hinaus auf ein soziales Gefüge hin zu erweitern. Der Sinn, den das eigene Tun und Leben dadurch erhält, ist, wie Peterson betont, gerade nicht subjektiv. Das gelte aber nicht nur für die Kategorie des Sinns, sondern auch für das psychische Wohlsein im Allgemeinen. Mit dieser Ansicht stellt Peterson sich ausdrücklich gegen seine eigene Zunft, die ihm zufolge die falsche Vorstellung populär gemacht habe, „psychische Gesundheit sei etwas Subjektives“. Insofern Sinn an Verantwortung gekoppelt ist, leuchtet auch unmittelbar ein, dass der Sinn des Lebens „nicht in selbstsüchtigen, eng gefassten und unmittelbaren Zielen oder Antrieben“ liegen kann. Stattdessen ist Sinn für Peterson nichts anderes als das erfolgreiche In-Verantwortung-Stehen selbst. Wer aber Verantwortung trägt, der muss auch leidens- und opferbereit sein. Der Sinn ist nach Peterson also letztlich „im Dienst zu finden“.
Immer wieder verwendet Peterson, sowohl alleine als auch zusammen mit Pageau, biblische Bilder, um seine Gedanken zu illustrieren. Für die Idee einer Hierarchie, die Identität, Verantwortung und Sinn umfasst, führt er die Himmelsleiter des Jakob an: Es ist der Gedanke einer hierarchischen Ordnung, die das Sinnliche mit dem Übersinnlichen verbindet, die von den alltäglichsten Aktivitäten, wie der einen Tisch zu decken oder sein Zimmer aufzuräumen, bis in die himmlischen Sphären und damit letztlich zu Gott führt. Allerdings bleibt in typisch petersonscher Manier unklar, inwieweit hier wirklich Gott selbst ins Spiel kommt oder doch nur eine menschliche Vorstellung von etwas, das den Menschen in seiner Endlichkeit übersteigt: „Der Geist, der diese ganze Hierarchie durchdringt und an ihrer Spitze steht, ist so etwas wie der Geist der Güte selbst. Dieser Geist wird klassischerweise mit dem Höchsten in Verbindung gebracht, und dies wiederum assoziieren wir Menschen mit Gott.“ Das letzte klare Bekenntnis zu Gott kann sich Peterson, dessen Ehefrau Tammy erst kürzlich zum katholischen Glauben konvertiert ist, offenbar doch noch nicht abringen.
Klassisch liberal statt konservativ
Wer Petersons Essay über Identität aufmerksam liest, wird feststellen, dass die typische Einordnung als „Konservativer“ eigentlich nicht richtig auf ihn passen will. Denn Petersons Denken fehlt es an jenem skeptisch-pessimistischen Realismus, der den Konservativen auszeichnet. Stattdessen legt der Star-Psychologe einen geradezu überschwänglichen Optimismus an den Tag, wie er für aufklärungsbegeisterte Progressive charakteristisch ist. „Mir ist“, schreibt Peterson im Stil einer sich selbst erfüllenden Prophezeiung, „als gäbe es keine Wüste, die wir nicht zum Blühen bringen könnten, wenn nur genügend von uns erkennten, dass da nichts ist, was wir nicht erreichen können.“ So spricht ein klassischer Liberaler, der ganz auf den Menschen setzt. Jedoch wirft dies die Frage auf, ob Peterson damit nicht jener Denkweise Vorschub leistet, aus der der gegenwärtige Kulturkampf gegen den gesunden Menschenverstand überhaupt erst hervorgegangen ist.
Stärker noch als Peterson Solo-Aufsatz ist seine Kollaboration mit Pageau. Wie, so lautet die Ausgangsfrage ihres gemeinsamen Essays, können „wir unsere Identität sowohl praktisch begreifen als auch ideell realisieren“. Zu den besten Passagen des gesamten Buches zählen jene, in denen die beiden Autoren beschreiben, wie sich die Atomisierung des Individuums und die Ausweitung staatlicher Kontrolle in alle Lebensbereiche – beide Phänomene lassen sich gegenwärtig bestens beobachten – gegenseitig bedingen. Denn indem der Einzelne aus gemeinschaftlichen Zusammenhängen wie Partnerschaft, Familie, Nachbarschaft, Arbeitsplatz, Stadt, Land und Nation gerissen wird, wird er auf seine niederen Instinkte und Gelüste zurückgeworfen. Gleichzeitig füllt der paternalistische Staat die Lücke, die durch die Atomisierung der Einzelnen geschaffen wurde. Dieser Staat, „der die Freiheit zum Ausleben jeder erdenklichen Laune verspricht“, reiße, so Peterson und Pageau, „all jene Kräfte an sich, die frei werden, wenn es zur Aufgabe verantwortungsvollen Verhaltens kommt.“
Subsidiarität als Schlüsselbegriff
In der Sache geht dieser Befund freilich auf Alexis de Tocquevilles geniale Analyse der liberalen Demokratie in „Über die Demokratie in Amerika“ (1835/1840) zurück, was die Autoren aber erstaunlicherweise mit keinem Wort erwähnen. Allerdings ist ihre Herleitung dieses Zusammenhangs von Individualismus und staatlichem Despotismus durchaus neu und eigenständig, insofern sie auf die „Offenbarung des Johannes“ zurückgreift. Aus diesem letzten Buch der Bibel bezieht das Autorenduo dann auch die Inspiration für ihren Gegenentwurf zum dystopischen, vom totalitären Staat gestützten Individualismus: Das neue Jerusalem sei „das beste literarische Beispiel für eine differenzierte und vielschichtige Identität.“
Das restliche Buch ist der Entfaltung dieser Idee einer komplexen und stabilen Identität gewidmet. Überraschend ist dabei, dass die Verfasser an entscheidender Stelle ausdrücklich auf die katholische Soziallehre und ihr Grundprinzip der Subsidiarität zurückgreifen: Die jeweils höhere soziale Ebene darf und soll erst dann in das Eigenleben eines gemeinschaftlichen Gefüges unterstützend eingreifen, wenn dieses die ihm eigentümliche Funktion nicht mehr selbst ausüben kann. Wenn schließlich am Ende des Buches von der „ultimativen Opfergeste“ und der „Verkörperung des ewigen logos, das im Dienst der Liebe die Wahrheit spricht“ die Rede ist, fehlt eigentlich nur noch der Name dieses verkörperten Logos: Jesus Christus. Vielleicht fällt er ja endlich in Petersons nächstem Buch.
Jordan B. Peterson und Jonathan Pageau: Die Essenz des Seins. Über das Zusammenspiel von Identität und Verantwortung. Fontis Verlag, Basel, 144 Seiten, gebunden, EUR 15,90
Die Printausgabe der Tagespost vervollständigt aktuelle Nachrichten auf die-tagespost.de mit Hintergründen und Analysen.