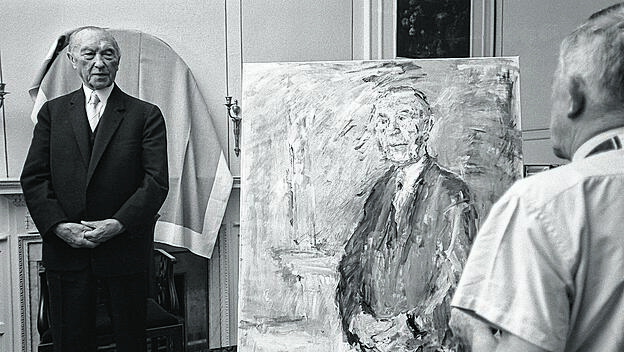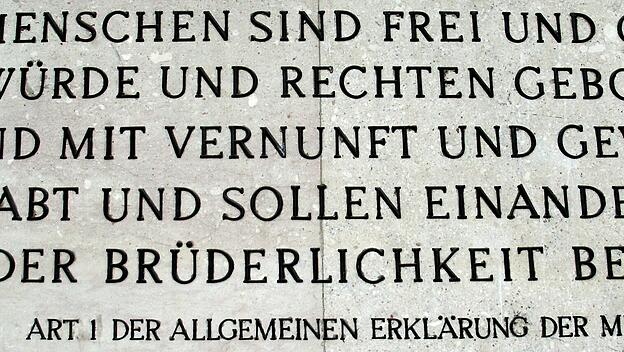Herr Hösle, in welchem Zustand befindet sich das Christentum heute, zum einen in kultureller und zum anderen in religiöser Hinsicht?
Im Grunde gehören beide Aspekte zur sozialen Frage: Was ist sozial noch wirksam am Christentum? Eine weitere, dritte Dimension ist die Wahrheitsfrage. Die hat mit der sozialen Frage recht wenig zu tun. Religion mag sehr einflussreich sein und keinen großen Wahrheitsgehalt haben. Umgekehrt mag eine Religion an sozialer Wirksamkeit verlieren, ohne dass das einen Einfluss hat auf die Gültigkeit ihrer Botschaft.
Um bei der sozialen Frage zu beginnen: Wie fällt Ihre Diagnose hier aus?
Mit Bezug auf die religiöse Dimension ist klar, dass besonders Europa sich in einem unglaublich schnellen Säkularisierungsprozess befindet, der sich bereits daran zeigt, dass immer weniger Menschen zur Kirche gehen. Aber es gibt natürlich auch eine andere, kulturelle Dimension. Selbst in einer Gesellschaft, in der Religionsfreiheit besteht und in der sich deswegen eine Pluralität von religiösen Orientierungen findet, gibt es so etwas wie einen sich in den Institutionen niederschlagenden Geist des Christentums. Hans Joas, der bedeutende deutsche Soziologe, hat zu Recht darauf hingewiesen, dass der Begriff der Menschenrechte eine Form des Weiterwirkens der Kategorie des Sakralen im Bereich des Juridischen ist. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass Jacques Maritain, einer der bedeutendsten Neuscholastiker des 20. Jahrhunderts, die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte von 1948 entscheidend mit beeinflusst hat. Was ich sagen will: Selbst in einem weitgehenden säkularen Staat wie Deutschland haben wir wesentlich mehr an christlichem Erbe in der Verfassung, als man vielleicht auf den ersten Blick vermutet. Und insofern würde ich sagen: Auch wenn der Kirchgang zurückgeht, ist es nicht richtig zu sagen, dass das Abendland entchristlicht sei, weil ganz entscheidende Institutionen und Grundwerte sich weiter aus christlichem Gedankengut speisen.
Es gibt diese kulturellen Sedimente des Christentums. Aber ist nicht die Verbindung zur Transzendenz gekappt worden?
Es ist richtig, dass den Menschen die historische Verbindung zum Christentum häufig nicht mehr bewusst ist. Jedoch besteht kein Zweifel, dass etwa Thomas von Aquin und die überwältigende Mehrzahl der christlichen Naturrechtslehrer daran festgehalten haben, dass der Naturrechtsgedanke nicht an das Christentum gebunden ist. Das Naturrecht bindet alle Menschen aufgrund ihrer Vernunftnatur. Die Frage ist aber: Setzt der Naturrechtsgedanke nicht wenigstens den Gottesbegriff voraus? Thomas von Aquin ist sicher dieser Ansicht. Allerdings ist Thomas zugleich der Überzeugung, dass etwas nicht deswegen vernünftig ist, weil Gott es befiehlt, sondern dass Gott etwas befiehlt, weil es vernünftig ist. Auch wenn der Begriff der Menschenwürde unweigerlich etwas Absolutes und damit etwas der sozialen Realität gegenüber Transzendentes voraussetzt, darf diese Beziehung nicht im Sinne einer willkürlichen Setzung eines allmächtigen Schöpfers verstanden werden.
Wenn wir über das Moralische hinaus auf die individuelle Erlösungsdimension blicken: Gibt es hier nicht ein unerfülltes Bedürfnis?
Der Begriff der Erlösung kann auf unterschiedliche Weise verstanden werden. Es gab die Säkularisierung des Erlösungsversprechens in der marxistischen Idee von der klassenlosen Gesellschaft. Das ist sicher nicht das, was das Christentum will. Diese Übersetzung des christlichen Heilversprechens in eine innerweltliche Zukunft wird heute auch von kaum jemandem mehr ernst genommen. Dann gibt es noch eine ganz andere Art, Erlösung zu verstehen, und dafür ist das hegelsche System ein Beispiel. Erlösung besteht bei Hegel darin, die Vernunft in der Welt zu erkennen und sich mit ihr zu versöhnen. Sehr vieles davon ist übrigens in Kontinuität mit der christlichen Botschaft. Auch Thomas von Aquin will die Welt als Ausdruck einer göttlichen Vernunft deuten. Schließlich gibt es noch die Erlösung im Sinne einer individuellen Unsterblichkeit nach dem Tod, in der alles gut wird. Das fehlt bei Hegel ohne Zweifel. Ich bin der Meinung, dass dieser Glaube durchaus ein rationaler Glaube ist, dass er aber nicht den gleichen Stellenwert hat wie zum Beispiel der Glaube an die Unbedingtheit des Sittengesetzes und damit an die Unbedingtheit eines transzendenten Prinzips. Gott ist wichtiger als wir und seine Ewigkeit in ganz anderem Maße garantiert als unsere eigene.

Warum teilen heute so wenige den Glauben an eine unsterbliche Seele?
Einer der Gründe ist sicherlich der enorme Fortschritt der Neurowissenschaften, die einer breiteren Masse eine falsche, materialistische Deutung des Geistes nahegelegt haben. Ein anderer Grund dafür ist, dass der moderne Mensch häufig der Ansicht zu sein scheint, dass ein endliches Leben etwas ist, womit wir zufrieden sein sollten. Wir müssten unsere Endlichkeit anerkennen und es sei etwas Vermessenes, wenn wir ein ewiges Glück haben wollten. Es ist eine der Paradoxien des Glaubens: Wenn man einen eher traditionellen Gottesbegriff hat, sich Gott als einen gütigen und weisen Weltherrscher vorstellt, dann könnte man meinen, eine Welt, in der es den meisten gut geht, steigert den Glauben an Gott eher als eine Welt, in der viel Chaos herrscht. In Wahrheit ist es genau umgekehrt: Die Menschen werden religiöser, wenn es ihnen schlechter geht. Wenn man durch historische Katastrophen geht, in der das Leben vieler junger Menschen vernichtet worden ist, dann steigert sich das Bedürfnis nach einer Kompensation in einer anderen Welt. Da wir uns ohne Zweifel in den nächsten Jahrzehnten auf Krisen ungeahnten geschichtlichen Ausmaßes zubewegen, denke ich, dass diese Dimension der Religiosität zunehmen wird.
Sie sagen uns schlimme Zeiten voraus. Sind also die Verfallsklagen, die man aus den verschiedensten Richtungen hören kann, berechtigt?
Es sind verschiedene Aspekte, die wir unterscheiden müssen. Klar ist, dass mit der wissenschaftlichen Revolution im 17. Jahrhundert und mit der industriellen Revolution im späten 18. Jahrhundert eine Veränderung der Lebenswirklichkeit des Menschen erfolgt ist, wie sie es in dieser Form in der ganzen Menschheitsgeschichte noch nicht gegeben hat. Es kann sehr gut sein, dass die „Superstruktur“, wie sie Arnold Gehlen genannt hat, aus moderner Wissenschaft, Technologie und kapitalistischer Wirtschaft dazu führen wird, dass wir diese Erde völlig unbewohnbar machen. Das ist das ökologische Problem. Außerdem kann die Technik auch zur Abwehr von Gefahren eingesetzt werden – die größte Gefahr des Menschen ist aber der Mensch. Da wir inzwischen Waffen haben, die die ganze Menschheit vernichten können, ist es sehr gut möglich, dass das Projekt der Moderne durch den Einsatz von ABC-Waffen in einer Katastrophe endet. Die beiden Probleme können sich auch verschränken.
Gibt es auch innere, geistige Gründe für den Verfall, die nichts mit technischem Fortschritt zu tun haben?
Es gibt Theorien des Verfalls, die davon ausgehen, dass Hochkulturen nach einem bestimmten Sättigungspunkt erschlaffen, dass insbesondere die Fähigkeit, sich für etwas einzusetzen, was über das eigene Interesse hinausgeht, verschwindet und Menschen sich in einen hemmungslosen Hedonismus und Egoismus einigeln. Das ist eine der Erklärungen für den Niedergang Roms in der Spätantike. Dass Ähnliches auch in Europa in den letzten Jahrzehnten geschehen ist, ist offenkundig. Das, was ich in meinem Buch „Globale Fliehkräfte“ das goldene Vierteljahrhundert genannt habe, also die Jahre von 1989 bis 2014, war eine geschichtlich absolut einzigartige Zeit des Friedens und des Wohlstandes. Und diese ist 2014 beziehungsweise 2016 endgültig zu Ende gegangen: 2014 mit dem Beginn der russischen Invasion der Krim und 2016 mit dem Brexit und der Wahl Donald Trumps zum Präsidenten der USA. Damit ist das westliche Projekt nicht nur von außen bedroht, sondern die Demokratie scheint intern Verfallserscheinungen unterworfen zu sein. Wir alle wissen, dass es gut möglich ist, dass im Januar Donald Trump wieder ins Weiße Haus zurückkehrt. Die transatlantische Allianz hat schlechte Chancen, das zu überleben. Europa wird dann mit der russischen Bedrohung im Wesentlichen alleine fertig werden müssen. Dazu ist es aber miserabel gerüstet, einerseits militärisch, andererseits aber auch mental. Die Europäer haben in den letzten Jahrzehnten den Gedanken völlig aufgegeben, dass es Situationen geben kann, in denen man eine moralische Pflicht hat, das eigene Land auch mit Waffengewalt zu verteidigen.
Wie realistisch ist es, dass das Christentum sich durch diese Krisen hinüberrettet in den Beginn eines neuen Kulturzyklus?
Denkbar ist es ohne Zweifel, allerdings meine ich, dass das Christentum sich wird verändern müssen. Ich bin der Überzeugung – und damit kommen wir zur Wahrheitsfrage –, dass das Christentum auf einigen ganz entscheidenden Einsichten basiert, sowohl metaphysischer als auch moralischer Art. Und ich glaube, dass das, was der protestantische Theologe Adolf von Harnack mit einer gewissen negativen Bewertung die „Hellenisierung des Dogmas“ genannt hat, in Wahrheit zur Größe des Christentums beigetragen hat. Durch die gründliche Amalgamierung mit der griechischen Tradition, besonders mit dem Platonismus, ist in den ersten Jahrhunderten nach Christus eine philosophisch anspruchsvolle Religion entstanden – ich nenne nur Augustinus. Es ist jedoch unvermeidlich, dass wir diesen rationalen Kern des Christentums immer neu überdenken und immer neu anpassen an die Herausforderungen der Zeit.
Die Printausgabe der Tagespost vervollständigt aktuelle Nachrichten auf die-tagespost.de mit Hintergründen und Analysen.