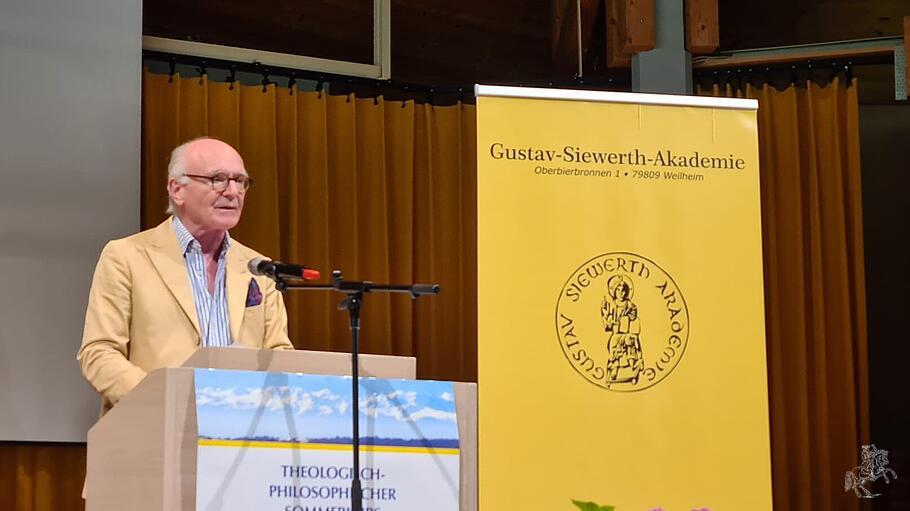Im weiteren Verlauf des Sommerkurses der Gustav-Siewerth-Akademie kamen zunächst Martin Mosebach und danach Bernhard Meuser zu Wort. Der Schriftsteller Mosebach sprach über das Problem der Schönheit in der Kunst und in der Kirche.
Sogar in offiziellen Dokumenten werde zuweilen noch von Schönheit in der Liturgie gesprochen, eröffnete Mosebach seinen Vortrag. Allerdings geschehe das etwas verlegen. Nach heutigem Verständnis sei dies gerade noch etwas Begleitendes. Man könne darauf verzichten, so der Schriftsteller, ohne die Liturgie in ihrer Essenz zu beeinträchtigen. Dabei verwies Mosebach auf Kardinal Simonie der in albanischer Haft Messen unter Todesangst in größter Einfachheit feierte, das sei nicht der Normalfall. Unter Verweis auf Vereinfachung der Architektur, der liturgischen Kleidung und liturgischer Gefäße zeigte Mosebach den aktuellen Trend auf. Man folge höchstens einer minimalistischen Ästhetik. Sie zeichne sich durch eine Kargheit aus, die jeden Unterschied von Sanctuarium und Laienbereich einebne, kritisierte der Schriftsteller.
Das verhängnisvolle Geschmackvolle
Diese Schlichtheit, welche man auch als das Geschmackvolle bezeichnet, weist Mosebach dem Bürgerlichen zu. Das sollte nachdenklich machen angesichts alter prachtvoller Kirchen. Pomp gehe auf die alten Beerdigungsriten zurück. Mosebach erklärte dies mit dem Bestreben, die Herzen zu erheben. Dagegen tauche Pomp heute eher bei Rockkonzerten, Olympiaden und Diktatoren auf.
Armut sei ein stiller Glanz von innen, zitierte Mosebach Rilke. Damit spielte er auf die etwas robuste Ästhetik moderner Paramente oder liturgischen Geschirrs an. Der Gegensatz sei eben das Wahre, Gute und Schöne. Dies falle ins Eins, stellte Mosebach unter Verweis auf Platon dar. Die Antike habe hier das Christentum geistesgeschichtlich vorbereitet. Mosebach stellte dies allegorisch so dar: „Das Gute ist der Vater, das Wahre ist Christus, die Schönheit ist das Geschenk des Heiligen Geistes.“ Die Kirche unsere Tage versuche, den Glaubensverlust als gegeben hinzunehmen. Die sei einer Folge der Theologie, die sich einer Philosophie in die Arme geworfen habe, die Wahrheit für unmöglich hält. Damit seien für die Kirche dann auch Schönheit und Güte der Kirche verloren gegangen.
Die Sinne seien eben nicht nur Täuschungen ausgesetzt, sie seien auf Grund der Fähigkeit, Schönheit wahrzunehmen, in hohem Maße wahrheitsfähig, erklärte der Schriftsteller. Die Seele wolle sich auf die Schönheit zubewegen. Über das Schöne lasse sich nicht abstrakt philosophieren, es bedürfe keiner Begründung im Sinne logischer Deduktion. Das Unendliche werde gerade durch die Schönheit erahnbar. Die Antike bereitete damit gedanklich die Inkarnation des Logos vor. In der Verklärung schauten später die Apostel die Verklärung, damit sei für sie die Wahrheit in der Schönheit anschaubar geworden.
Gegenwart erfahrbar machen
Katholische Liturgie solle geistliche Gegenwart sinnlich erfahrbar machen. Orte, an denen die göttliche Gegenwart erfahrbar sein solle, müssten zwingend besondere Schönheit aufweisen. Der Beginn des Kirchenbaus nach Konstantin entfalte sich zu einer neuen Größe durch Verschmelzung von Jerusalemer Tempel mit der römischen Kaiserhalle, der Basilika. Mosebach erklärte den Aufbau einer Kirche nach Konstantin mit diesen Elementen von Tempel und Basilika. Wie aber lasse sich dieser Luxus mit dem Leben Jesu verbinden, fragte der Schriftsteller. Jesu Liebe zum Tempel zeige einen Hinweis auf den Zusammenhang mit dieser Pracht. Jesus vergleiche sich sogar selber mit dem Tempel. Gefeiert werde letztendlich in der Liturgie nicht nur das irdische Leben, sondern auch die Wiederkunft Christi in Herrlichkeit. Kathedralen enthielten Maßstäbe von zeitgemäßer Kunst. Die Gegenwart des fleischgewordenen Gottes erlaube nur das Beste, so Mosebach. Die Liturgie verlange danach, das Erhabene sichtbar zu machen, darum bauten auch Bettelorden und Zisterzienser später prachtvolle Kirchen.
Nach den Revolutionen habe die Schönheit ihre Bedeutung gerade dort verloren, wo sie ihre eigentliche Heimat habe. Die Folgen für Architektur, Musik und Kunst seien überall sichtbar. Für die Religion sei dies eine Bedrohung, denn damit gehe ein Verlust des Glaubens an die Wiederkehr des Herrn in Herrlichkeit einher. Die Folge sei nicht zuletzt eine Flucht in den Kitsch, der ein Vorwurf an die sein sollte, die den Verlust der Schönheit zu verantworten haben. Schönheit stehe heute unter Verdacht, wenn sie durch die katholische Liturgie erlebbar sei. Sie stehe für eine Epoche, die in der westlichen Welt verworfen wurde.
Gesetze bringen Schönheit
Halte man sich an die überlieferten Gesetze des Kirchenbaus, so Mosebach, entstehe auch in unsere Zeit heiliger Raum. Aus der Originalität solle die Kirche erwachen. Es gelte Ballast abzuwerfen und wieder Schönheit zu finden. Als Beispiel nannte Mosebach die Rubriken, die als Rubrizismus verunglimpft würden. Ehrfürchtige Verfolgung der Rubriken lasse hingegen Schönheit als etwas nicht Selbstgemachtes erfahren. Dann erscheine die Schönheit. Das sei der Glanz des Richtigmachens.
Newman und „Real assent“
Bernhard Meuser schloss sich an mit einem Vortrag über einen besonderen Aspekt der Theologie John Henry Newmans, dem „Real assent“. Ein Buch über eine Schönheitskrise sei dies. Es gehe um den Erweis der „demonstratio catholica“, die zeige, dass die Kirche dem entspreche, was Christus als Kirche gewollt habe. Die Kirche sei in ein kommunikatives Loch geraten, "wir können die Kirche nicht einmal unseren Kindern erklären". Auch Newman habe eine Phase der Isolation durchlebt, in der er sich gezwungen sah, seine reichen Mittel, mit denen er Menschen bezaubern und mitreißen konnte, ruhen zu lassen, um in der Konzentration auf etwas Letztragendes an einer „demonstratio interna“ zu arbeiten, erläuterte Meuser.
Wer sich schon einmal näher mit John Henry Newman befasst habe, werde dem Wortpaar „real assent“ begegnet sein. Wörtlich übersetzt heiße das „reale Zustimmung“. Über zwanzig Jahre quälte sich Newman mit dem Buch „An Essay In Aid of A Grammar Of Assent“. Die innere Realität seines Gewissens habe Newman in die katholische Kirche gezwungen. Newman wollte die Wahrheit der Anglikanischen Kirche zwischen Katholischer Kirche und Reformation erweisen. Newman erkannte die Wahrheit der Kirche. Auch in der katholischen Kirche sei er auf Widerstand gestoßen. Vom jungen Star zum Modernisten geworden, habe er sich 20 Jahre zurückgezogen. Erst Leo XIII. ehrte den altgewordenen Mann und machte er den fast Vergessenen zu „il mio Cardinale“.
Zwischen Fundamentalismus und Rationalismus
Newman stand zwischen zwischen Fundamentalismus und Rationalismus. In der Apologia pro vita sua von 1864 kann man von einem fundamentalen Bekehrungserlebnis lesen, das Newman in jungen Jahren widerfuhr; es bestand in der Erkenntnis von zwei unbestreitbaren Gegebenheiten: „Ich selbst und mein Schöpfer.“ Weder der Kunst, noch in der Religion könne man aus Quellen zweiter Hand leben, fühlen und denken, stellte der junge Newman fest. Es könne keine Zustimmung zu abstrakten Definitionen sein, Sie müsse den einfachen Menschen ebenso zustimmungsfähig sein, wie gelehrten Theologen. Die Zustimmung müsse die ganze Person erfassen und ihn in ein unmittelbares Verhältnis zur Wirklichkeit Gottes bringen. Newman habe sich die Frage, wie Gott wirklich werde, gestellt. Er kreiste um die Frage: „Wie können die Wahrheiten des Glaubens auf eine Weise für uns wirklich werden, dass wir uns ihnen rational und existenziell nicht entziehen können?“



Christsein sei eben kein Begreifen Gottes, sondern eine personale Beziehung zu einem Lebendigen, Gegenwärtigen, jetzt auf eigene Weise Handelnden, - eine Beziehung durch vertrauensvollen Glauben. Was „real“ erscheine, so Meuser, sehen wir mit der ganzen Person angesprochen. Newmans notorisches Misstrauen gelte allen abgeleiteten Erkenntnissen, so Meuser, freischwebenden Gedanken und gefühlshaften Annäherungen an die "hard facts" der Gegenwart Gottes. Meuser zitiert Newman: „Religion als bloßes Gefühl“, sagt er in der Apologia, “ist für mich Traum und Blendwerk.“
Prinzipien des Glaubens
Zwei Prinzipien, das dogmatische Prinzip und das Gewissensprinzip, prägten den Glauben Newmans. Das Gewissen, so Newman, sei geeignet für den Gebrauch aller Klassen und Schichten von Menschen, für hoch und niedrig, jung und alt, Männer und Frauen, unabhängig von Büchern, gebildetem Denken, physikalischem Wissen oder Philosophie. Es sei für Newman, erklärte Meuser, eine so fundamentale Kategorie der Gottesvergewisserung, eine Art innerer Gottesbeweis, dass er selbst nach eigener Aussage ohne diese Stimme Atheist, Pantheist oder Polytheist geworden wäre.
Das Christentum, so erklärte Bernhard Meuser, sei für Newman eine Religion zusätzlich zur Religion der Natur. Daraus habe Newman den Liberalismus als den natürlichen Feind der Religion abgeleitet. Von da aus machte Meuser einen Sprung in unsere Zeit und in die zeitgenössische Theologie, es sei, als könne man sein Leben von der Lehre abschalten. Statt der Bestärkung und Zusicherung von Wahrheit und Geltung des Wortes Gottes werde von Theologen Ambiguitätstoleranz verlangt. Es gibt auch in letzten Dingen keine Wahrheit mehr, so der Theologe Meuser.
Die Exegese sehe heute keine Theologie des Neuen Testaments, nur sich überschneidende, einander widersprechende „Theologien“. Alles müsse im Vagen bleiben. Das ermächtige von allen Festlegungen zu befreien. Lebenswirklichkeiten würde zum zentralen Kriterium der Lebensgestaltung. Theologie mutiere so in eine Art ekklesiologische Autoimmunerkrankung. Wolle man Newman persönlich begegnen, so Bernhard Meuser zum Ende, rate er: „Greifen Sie zu seinen Gebeten.“ Meuser brachte einige Beispiele und bezeichnete diese als reale Zustimmungen, Akte des Einschwingens in die Wirklichkeit hinter allen Wirklichkeiten.
Auf einem Podium brachte der Herausgeber des Vatican Magazins, Dirk Weisbrod, zum Abschluss des Tages die Referenten und das Auditorium noch in ein abschließendes Gespräch.
Lesen Sie in der kommenden Ausgabe der Tagespost eine umfassende Reportage über den diesjährigen Sommerkurs der Gustav-Siewerth-Akadamie.