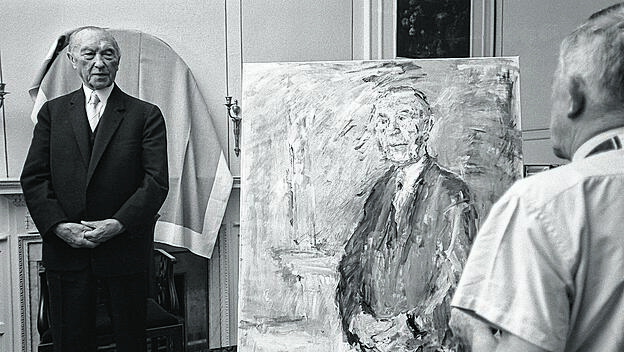Es ist ein Erfolg für die Kirchen, doch hat er noch Relevanz? Das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) hat am heutigen Donnerstag ein seit Langem erwartetes Urteil zum kirchlichen Arbeitsrecht gesprochen. Darin unterwirft sich das höchste deutsche Gericht den Vorgaben des Europäischen Gerichtshofs, der in dem Fall bereits 2018 urteilte. Dennoch stärkt Karlsruhe die „korporative Religionsfreiheit“ und das Selbstbestimmungsrecht der Religionsgemeinschaften.
Ausgangspunkt des seit 2012 laufenden Rechtsstreits war die Klage der Sozialpädagogin Vera Egenberger, die sich auf eine Stelle bei der Diakonie beworben hatte, bei der es um ein Forschungsprojekt über Antirassismus ging. Da Egenberger nicht, wie in der Stellenausschreibung gefordert, Kirchenmitglied war, sondern aus der Kirche ausgetreten war, wurde sie nicht zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen. Dagegen klagte die heute 63-Jährige mit Berufung auf das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz, welches wiederum auf eine EU-Richtlinie zur Nichtdiskriminierung zurückgeht. Der Fall landete schließlich beim Europäischen Gerichtshof, der entschied, dass Gerichte – der kirchlichen Selbstbestimmung zum Trotz – auch kirchliche Personalentscheidungen daraufhin prüfen können müssten, ob die Kirchenzugehörigkeit objektiv geboten und verhältnismäßig sei. Auf Grundlage dieser Vorentscheidung verurteilte das Bundesarbeitsgericht (BAG) die Diakonie zu einer Entschädigungszahlung an Egenberger, wogegen diese Verfassungsbeschwerde einlegte.
Damit war die Diakonie, der Wohlfahrtsverband der Evangelischen Kirche (vergleichbar mit der Caritas), nun erfolgreich. Das BVerfG hob das Urteil des BAG sechs Jahre nach der Beschwerde der Diakonie auf und verwies den Fall zurück. Nun wird sich das BAG erneut unter Beachtung des Karlsruher Urteils noch ein letztes Mal mit dem Fall beschäftigen müssen.
Die Kirche muss selbst begründen dürfen, warum sie die Mitgliedschaft für notwendig hält
Inhaltlich pocht das BVerfG auf eine Auslegung des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes, die zwar das Unionsrecht achte, aber dabei die gegebenen Gestaltungsspielräume der einzelnen EU-Mitgliedstaaten nutze. Konkret fordert Karlsruhe eine zweistufige Prüfung: Zunächst müsse die Religionsgemeinschaft vor Gericht „plausibel“ darlegen, inwiefern sich objektiv ein direkter Zusammenhang zwischen der Tätigkeit und der Kirchenmitgliedschaft ergebe. In einem zweiten Schritt müssten Gerichte die Verhältnismäßigkeit der Forderung einer Kirchenmitgliedschaft prüfen, wobei „dem religiösen Selbstverständnis aufgrund seiner Nähe zum vorbehaltlos gewährten Recht auf korporative Religionsfreiheit (Art. 4 Abs. 1 und 2 GG) ein besonderes Gewicht“ beigemessen werden könne.
Das BAG aber habe in seiner nun kassierten Entscheidung das religiöse Selbstbestimmungsrecht nicht hoch genug gewichtet. So habe das Gericht etwa die europäischen Antidiskriminierungsvorgaben „überspannt“, indem es sich mit der kirchlichen Darlegung, nach der die Stelle „wesentlich“ eine glaubwürdige Vertretung des kirchlichen Ethos nach außen erfordere, gar nicht auseinandergesetzt habe. Das Gericht habe, obgleich die Kirche „plausibel – und damit ausreichend“ argumentiert habe, „maßgeblich auf die eigene Sichtweise“ abgestellt.
DBK begrüßt Entscheidung
Dass sich mit der neuen Entscheidung letztlich für die Kirchen nicht viel ändern dürfte, bestätigte in einer ersten Reaktion auch die Deutsche Bischofskonferenz. Man begrüße die Entscheidung, das Selbstbestimmungsrecht der Kirchen werde damit „nachdrücklich“ bestätigt: „Die Formulierung des kirchlichen Propriums obliegt allein den Kirchen und ist als elementarer Bestandteil der korporativen Religionsfreiheit durch Art. 4 Abs. 1 und 2 Grundgesetz verfassungsrechtlich geschützt“, so die Pressemitteilung. Und weiter: „Wo die Bedeutung der Religion für die Tätigkeit und Stellung einer Arbeitnehmerin oder eines Arbeitnehmers plausibel dargelegt werden kann, kann die Kirchenmitgliedschaft weiterhin Bedingung einer Beschäftigung sein.“ Handlungsbedarf ergebe sich nun aber nicht, die Entscheidung bestätige die vorhandenen Regelwerke. Schon mit der letzten Neufassung der „Grundordnung des kirchlichen Dienstes“ im Jahr 2022 habe man „die verfassungsrechtlichen und europarechtlichen Rahmenbedingungen gewürdigt.“ Tatsächlich waren bei der letzten Novelle insbesondere die kirchlichen Anforderungen an die Lebensführung der Mitarbeiter reduziert worden: Der „Kernbereich privater Lebensgestaltung, insbesondere Beziehungsleben und Intimsphäre“ soll seither rechtlichen Bewertungen entzogen sein, also keine Kündigungen mehr rechtfertigen. Eine Zugehörigkeit zur katholischen Kirche wird weiterhin insbesondere im katechetischen und pastoralen Dienst verlangt.
Auch die evangelische Kirche hat ihre Mitarbeitsrichtlinie unter dem Eindruck des EuGH- sowie des BAG-Urteils geändert, zuletzt 2024. Dass die Diakonie dennoch klagte, liege daran, dass es um eine grundsätzliche Frage gehe, sagte Diakonie-Geschäftsführer Max Mälzer vor der Entscheidung der „Legal Tribune Online“: „Für Kirche und Diakonie geht es um eine grundgesetzlich hinterlegte Rechtsposition, die über den Umweg des europäischen Antidiskriminierungsrechts bedroht ist. Deshalb konnte die Diakonie eigentlich gar nicht anders als zu kämpfen.“ Die Vorgaben zur Kirchenmitgliedschaft seien aber sowieso mittlerweile offener und tätigkeitsbezogener gestaltet. Insofern dürfte sich ein Fall Egenberger so oder so nicht wiederholen. (DT/jra)
Die Printausgabe der Tagespost vervollständigt aktuelle Nachrichten auf die-tagespost.de mit Hintergründen und Analysen.