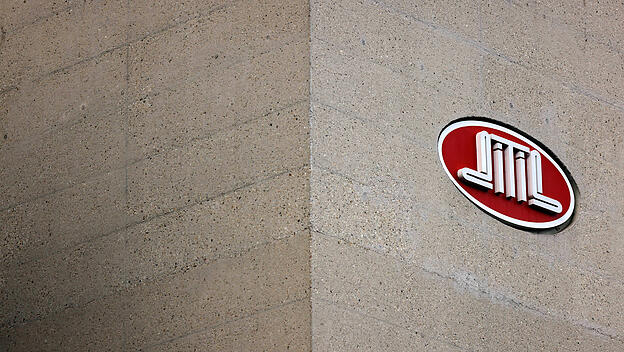Ein „Trost“, ein Zeichen der „Solidarität“ sollte er in Corona-Zeiten sein: der Ruf des Muezzins über Lautsprecher. Moscheegemeinden haben ihn in ganz Deutschland beantragt. Der Adhan-Gebetsruf schallt seitdem über mehrere Städte. Darin wird nicht nur zum Gebet gerufen, sondern auch das Glaubensbekenntnis des Islams rezitiert: Es gibt keinen Gott außer Allah, und Mohammed ist sein Prophet.
Die anfängliche Sympathie scheint mittlerweile verflogen. In der hessischen Kleinstadt Haiger kündigte der Ausländerbeirat den Gebetsruf per Facebook an. Doch die CDU grätschte dazwischen. Die Kritik auf die Kritik folgte prompt: der Beirat bemängelte die „Intoleranz“ der CDU. Der Muezzin in Haiger bleibt dennoch stumm. „Wir sehen den sozialen Frieden in Gefahr“, sagt Sebastian Pulfrich, der Vorsitzende der CDU Haiger, gegenüber der „Welt“. Burhan Kesici vom Koordinationsrat der Muslime kritisiert, dass Kirchenglocken zur Unterstützung der Menschen erklängen, der Muezzin aber nicht.
Debatte reißt alte Wunde auf
Die Debatte reißt eine alte Wunde auf: Verstößt es gegen die Freiheit der Religionsausübung, dass die Kirchenglocken über die Dächer läuten, der Muezzin über Lautsprecher aber nicht rufen darf? Für Bedenken haben Vorfälle wie in Berlin-Neukölln gesorgt, als sich 300 Muslime nach dem Gebetsruf an der Moschee zusammenfanden. Das Zeichen in Corona-Zeiten konterkarierte den Infektionsschutz. Und: handelt es sich bei dem Ruf wirklich nur um ein „Zeichen“?
Seyran Ates von der liberalen Ibn Rushd-Goethe Moschee in Berlin bewertete den Ruf als „Sieg über die Ungläubigen“ und als „Vorboten eines Kulturkampfes“ in einem Artikel des Magazins „Cicero“. Auch der Augsburger Theologe Johannes Hartl kritisierte diese einseitige Sicht: „Es geht beim Muezzinruf aber eben nicht primär um ‚Trost‘. Der Ausruf ‚Allahu Akbar‘ bedeutet: ‚es gibt keinen Gott außer Allah‘. Es ist eine letztlich imperialistische Proklamation im öffentlichen Raum und allein schon deshalb deutlich vom Glockenläuten verschieden.“ Die Äußerung sorgten für eine Diskussion auf dem Internetdienst Twitter.
Die Krefelder FDP preschte mit einem Antrag vor, der Glockenläuten und Muezzin-Ruf nicht nur gleichsetzen, sondern auch verstetigen soll. „Sowohl aus immissionsrechtlicher wie aus Sicht der Religionsfreiheit keine andere Beurteilung vorzunehmen wie bei der Einordnung christlichen Glockengeläutes. Deshalb hinterfragen wir die Befristung der Genehmigung für Gebetsrufe“, erklärte der FDP-Fraktionsvorsitzender Joachim Heitmann gegenüber der „Rheinischen Post“.
Gröhe: Richtig, vor Ort zu entscheiden
Hermann Gröhe, der Beauftragte für Kirchen und Religionsgemeinschaften der Unionsfraktion im Bundestag, stellte gegenüber der Tagespost heraus, dass es richtig sei, dass „vor Ort entschieden“ und damit Rücksicht auf die Nachbarschaft und die örtlichen Gegebenheiten genommen werde. Der Neusser Bundestagsabgeordnete zeigte sich jedoch skeptisch hinsichtlich der Verstetigung des lautsprecherverstärkten Muezzin-Rufes. „Der Muezzin-Ruf ist eine verbale, exklusive Gottesverkündung“, er sei damit „Bestandteil des Gebetes“ und eine „kultische Handlung“, so Gröhe. „Das ist etwas anderes als das abstrakte Glockengeläut, das zum Gebet ruft. Ich halte die Gleichsetzung daher für falsch.“
Auch das Katholische Büro äußerte Zweifel daran, ob eine solche Gleichsetzung sinnvoll sei. Zwar dürften „in einer religionsoffenen Gesellschaft, die unser Grundgesetz auch zu unserem Vorteil ermöglicht und schützt“ fraglos auch nichtchristliche religiöse Traditionen und Übungen in der Öffentlichkeit praktiziert werden, soweit keine entgegenstehenden Rechte und Gesetze verletzt würden. Insofern stimme es, dass der Ruf des Muezzins immissionsrechtlich nicht anders zu bewerten sei; auch könnte es in besonderen Situationen angemessen sein, den Gebetsruf zuzulassen.
„Unabhängig davon ist das Glockengeläut in Deutschland nicht nur ein religiöser Ausdruck, sondern auch eine jahrhundertealte Kultur, der eine platte Gleichsetzung mit einem Ruf über Lautsprecher nicht gerecht wird“, erklärte Antonius Hamers in einer Stellungnahme gegenüber der Tagespost.
Lesen Sie einen Kommentar zur Debatte um den Muezzin-Ruf in der kommenden Ausgabe der Tagespost. Holen Sie sich das ePaper dieser Ausgabe kostenlos