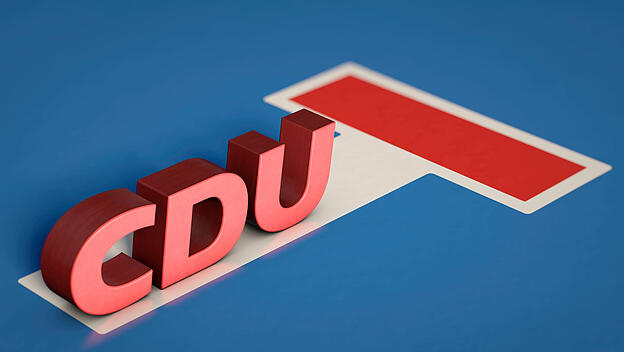Laut einer aktuellen Umfrage von Forsa befürworten 54 Prozent der Deutschen die Wiedereinsetzung der Wehrpflicht. Ironisch, dass diese Forderung gerade von denjenigen kommt, die selbst zu alt für den Dienst an der Waffe wären: die Generation 60plus. Unter den Parteianhängern sind es mit 74 Prozent die Wähler der CDU und CSU, welche die Wehrpflicht am stärksten unterstützen. Dabei war es gerade Angela Merkel, die für deren Aussetzung verantwortlich ist.
Im Bundestag wurde jüngst über eine Wehrpflicht per Losverfahren verhandelt. Dieser Kompromiss ist inzwischen geplatzt. Dies zeigt, wie schwer sich die Bundesregierung tut, auf die sicherheitspolitische Realität zu reagieren. Dass die Frage nach der Rückkehr zur Wehrpflicht überhaupt wieder Einzug in den politischen Diskurs genommen hat, liegt vor allem daran, dass auch der Krieg in Europa sein Comeback gefeiert hat. Seit dem Beginn des Ukraine-Kriegs besteht auch hier die endgültige Gewissheit, dass sich militärische Konflikte nicht immer mit diplomatischen Mitteln oder mit Sanktionsdrohungen vermeiden lassen.
Die Zustimmung zur Wehrpflicht in der Bevölkerungsmehrheit ist wohl weniger Ausdruck einer Kriegslüsternheit, sondern eines tiefen Bedürfnisses nach Sicherheit. Im Fall der Fälle will man dazu bereit sein, sich gegen einen Aggressor zur Wehr zu setzen. Die Motive der Minderheit der Wehrpflichtskeptiker dürften ganz unterschiedlich sein, nicht zu unterschätzen ist freilich die in den letzten Jahren stetig gestiegene Skepsis gegenüber den Repräsentanten und Institutionen des Staates. Nach dem Motto: Wer kann garantieren, dass die aufgerüstete Armee nicht im Interesse „fremder Mächte" kämpft anstatt im eigenen? Nicht wenige Menschen gerade im Osten Deutschlands fürchten, die Regierung plane womöglich, deutsche Soldaten irgendwann in der Ukraine zu „verheizen“. Auch deshalb ist die AfD, aktuell immerhin umfragenstärkste Partei, in der Wehrpflichtfrage derzeit gespalten.
Die Wehrpflicht ist im Prinzip eine sinnvolle Institution. Doch sie kann nur funktionieren, wenn sie auf Vertrauen in den Staat und seine Institutionen gründet. Denn Wehrpflicht bedeutet nicht automatisch Wehrhaftigkeit. Eine Armee braucht nicht nur Mannstärke, sondern auch Moral. Wie die Bürger, die hinter der Armee stehen sollen, müssen auch die Soldaten wissen, wofür sie kämpfen – und für wen. Auch wenn die Regierung sich im Wehrpflichtstreit noch zu einer gemeinsamen Lösung zusammenrauft, erst danach fängt die wirkliche Mammutaufgabe an: die Zeitenwende im beschädigten Vertrauensverhältnis zwischen Staat und Bürgern hinzubekommen.
Die Printausgabe der Tagespost vervollständigt aktuelle Nachrichten auf die-tagespost.de mit Hintergründen und Analysen.