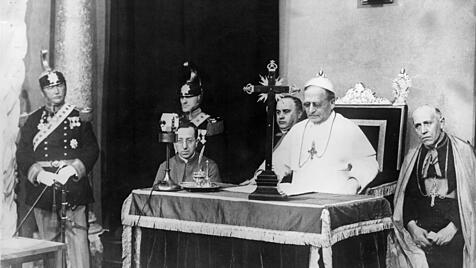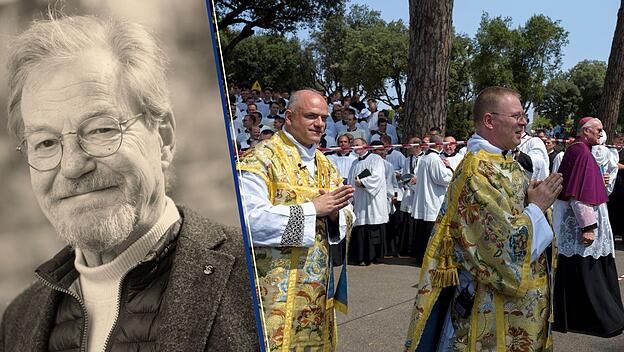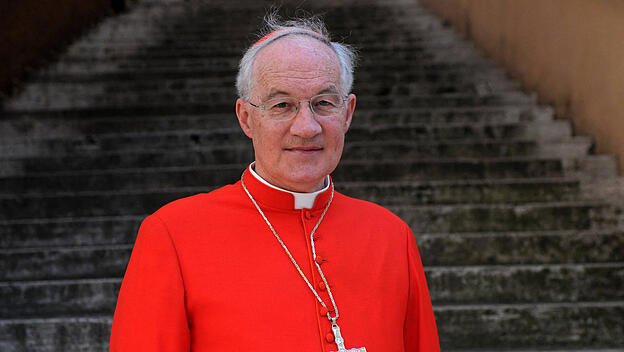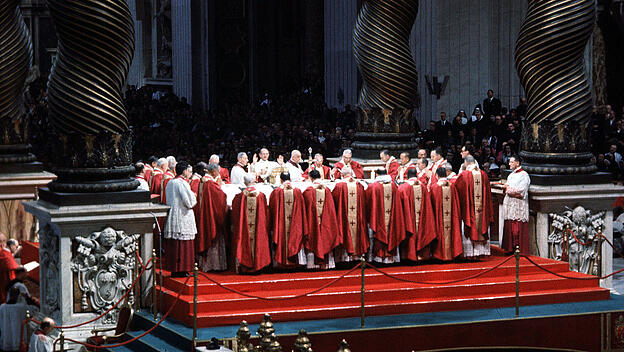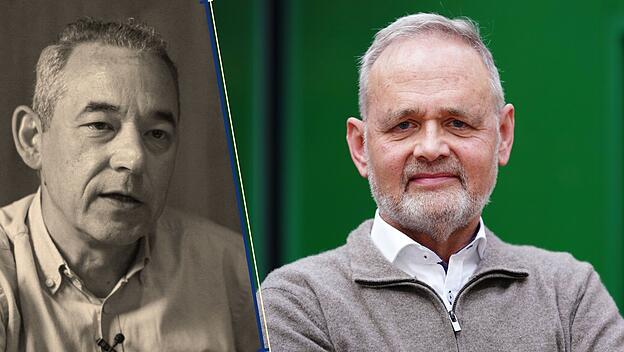Papst Franziskus

Papst Franziskus (gebürtig Jorge Mario Bergoglio, *17. Dezember 1936) war seit dem 13. März 2013 Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche und bis zu seinem Tod am 21. April 2025 Bischof von Rom sowie Staatsoberhaupt des Vatikanstaates. Er war der erste Papst aus Lateinamerika, der erste Jesuit auf dem Papstthron und der erste Nicht-Europäer seit dem 8. Jahrhundert.
Steckbrief
| Merkmal | Information |
| Geburtsname | Jorge Mario Bergoglio |
| Geburtsdatum | 17. Dezember 1936 |
| Geburtsort | Buenos Aires (Argentinien) |
| Eltern | Vater: Mario José Bergoglio (Italien-Einwanderer), Mutter: Regina María Sívori |
| Ordinierung zum Priester | 13. Dezember 1969 |
| Amtsbeginn als Papst | 13. März 2013 |
| Tod | 21. April 2025 |
Karriere und Werdegang
Jorge Mario Bergoglio wuchs in Buenos Aires in einer von italienischen Einwanderern stammenden Familie auf. Nach einem technischen Schulabschluss (Chemietechniker) trat er im Jahr 1958 in den Noviziat der Jesuiten ein. 1969 wurde er zum Priester geweiht, 1973 legte er die ewigen Gelübde der Gesellschaft Jesu ab. Er lehrte Philosophie und Literatur, war später Provinzial der Jesuitenprovinz in Argentinien.
1992 wurde er Weihbischof von Buenos Aires, 1998 Erzbischof von Buenos Aires. 2001 erhob ihn Papst Johannes Paul II. zum Kardinal. Am 13. März 2013 wurde er auf dem Konklave in Rom zum Papst gewählt und nahm den Namen Franziskus an.
In seinem Pontifikat setzte Franziskus mehrfach Schwerpunkte – etwa durch Verkündigungen in seiner Apostolischen Exhortation „Evangelii gaudium“, der Enzyklika „Laudato si’“ zum Schutz der Umwelt und der apostolischen Schrift „Amoris laetitia“ zur Familie. Er leitete Reformen in der Kurie, richtete eine Kommission zur Reform der Vatikanischen Bank ein und änderte zentrale kirchliche Lehren, etwa zur Todesstrafe, die als „unzulässig“ erklärt wurde.
Politische und kirchenpolitische Positionen/Themen
Umwelt- und Klimapolitik: Betonung der ökologischen Verantwortung; mit „Laudato si’“ prägte er eine kirchliche Stellungnahme zum Klimawandel und zur Bewahrung der Schöpfung.
Soziale Gerechtigkeit & Migration: Schwerpunkt auf Solidarität mit Armen und Ausgegrenzten; Kritik an einer „Globalisierung der Gleichgültigkeit“ gegenüber Leid und Armut.
Kirchenreform & Kurie: Einsatz für eine dezentralere Kirche, vermehrte Kardinalsernennungen außerhalb Europas und Betonung pastoraler Nähe.
Moral- und Lehrfragen: Erklärung der Todesstrafe als grundsätzlich unzulässig; zugleich Beibehaltung traditioneller Lehraussagen zur Ehe zwischen Mann und Frau sowie pastoralere Zugänge für geschiedene und wiederverheiratete Katholiken.
Interreligiöser Dialog & Außenpolitik: Kontakte zu Führern anderer Religionen; wiederholte Aufrufe zu Frieden und Dialog, u. a. mit Blick auf den Krieg in der Ukraine.
Synodaler Prozess & Verhältnis zum deutschen Synodalen Weg
Ein zentrales Merkmal seines Pontifikats war die Einberufung des weltweiten „Synodalen Prozesses“, mit dem Franziskus die Kirche zu mehr Hören, Partizipation und gemeinsamer Unterscheidung führen wollte. Er verstand Synodalität als geistlichen Weg und weniger als parlamentarisches Modell kirchlicher Entscheidungsfindung.
In Bezug auf den deutschen Synodalen Weg zeigte Franziskus Wertschätzung für das Engagement zur Erneuerung, äußerte zugleich jedoch Vorbehalte gegenüber einer zu starken Nationalisierung kirchlicher Reformprozesse. Mehrfach mahnte er, dass Reformen nur in Einheit mit der Weltkirche und in einem geistlich begleiteten Prozess stehen dürfen.
Gleichwohl stärkte er die Beteiligung von Laien an Beratungsprozessen und förderte eine neue synodale Kultur des Zuhörens. Damit wurde unter seinem Pontifikat Synodalität zu einer kirchenleitenden Grundhaltung, die weltweit an Bedeutung gewann.
Zitate
„Wer bin ich, dass ich über einen anderen Menschen richte?“ (Interview, Juli 2013)
„Wir können nicht zulassen, dass das Mittelmeer zu einem großen Friedhof wird.“ (Rede vor dem Europäischen Parlament, November 2014)
„Die Todesstrafe ist inadmissibel, weil sie einen Angriff auf die Unverletzlichkeit und Würde der Person darstellt.“ (Lehre der Kirche, 2018)
Werke/Publikationen
Evangelii gaudium (Apostolische Exhortation, 2013)
Laudato si’ (Enzyklika über Umwelt und Schöpfung, 2015)
Amoris laetitia (Apostolische Exhortation zur Familie, 2016)
Weitere Lehr- und Apostolische Schreiben, Ansprachen und Dokumente, die unter seinem Pontifikat veröffentlicht wurden.
Vermächtnis/Nachwirkung
Papst Franziskus hinterlässt ein umfangreiches Erbe in der Führung der katholischen Kirche – geprägt von einer sichtbaren Betonung der Armen, Migranten und Umweltfragen sowie von Reformimpulsen in Struktur und Lehre der Kirche. Seine Wahl als erster Papst aus Lateinamerika und als erster Jesuit markierte eine Zäsur in der Papstgeschichte.
Unter seiner Leitung erhielt Synodalität eine neue Bedeutung als Leitprinzip kirchlicher Entscheidungsfindung, und er stärkte den weltkirchlichen Charakter des Papsttums, indem er Stimmen aus dem globalen Süden stärker einband.
Seine Amtszeit förderte eine pastorale Ausrichtung, die Nähe zu Menschen in Ausgrenzung sucht, und eröffnete Diskussionen über Reformen in der Kirche, die über sein Pontifikat hinaus wirken. Zugleich blieb er mit Blick auf zentrale Lehren weitgehend in der Tradition. Seine Wirkung wird in den kommenden Jahren bezüglich kirchlicher Reformen, globaler Rolle der Kirche und interreligiösem Dialog weiter spürbar sein.
Fragen und Antworten (FAQ)
Welcher Name ist der Geburtsname von Papst Franziskus?
Jorge Mario Bergoglio.
Wann wurde er Papst?
Am 13. März 2013.
Aus welchem Land stammt er?
Aus Argentinien (Buenos Aires).
Welche Enzyklika veröffentlichte er zum Thema Umwelt?
Laudato si’.
Was war ein markantes Reformthema seines Pontifikats?
Die Stärkung der Synodalität und – auf lehramtlicher Ebene – die Erklärung, dass die Todesstrafe inadmissibel ist.