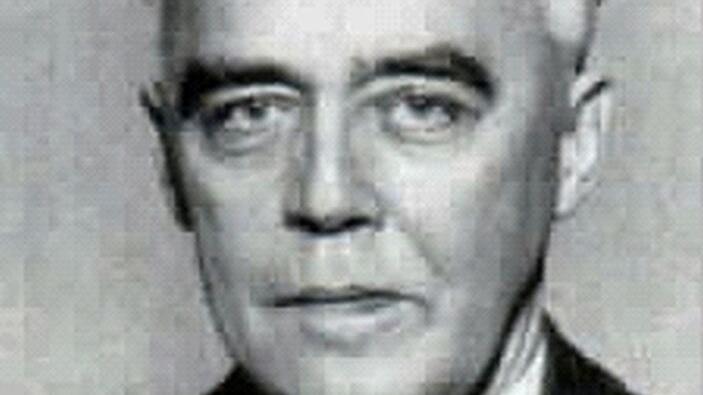Seine berufliche Laufbahn hat viele Facetten; er ist Wissenschaftler, Staatsbeamter, Abgeordneter und Minister. Die Wurzeln seiner wissenschaftlichen Arbeit, die zur Grundlage der Sozialen Marktwirtschaft werden, reichen bis in die 1930er Jahre zurück. In der Zeit des Nationalsozialismus gehört er zum Widerstand im „Freiburger Konzil“ und hält Kontakt zu den Kreisen um Carl Friedrich Goerdeler. Ludwig Erhard wird später über Franz Böhm formulieren, dass die Durchsetzung der Sozialen Marktwirtschaft ohne Böhms Arbeit wesentlich höhere Hürden hätte überwinden müssen.
1895 in Konstanz geboren, wächst Franz Böhm in einer Familie auf, die durch das badisch-protestantische Bürgertum am Bodensee geprägt ist. Nach der Teilnahme am Ersten Weltkrieg, die ihn bis ins Heilige Land führt, studiert Böhm Rechtswissenschaft in Freiburg. Nach einer kurzen Tätigkeit als Staatsanwalt wechselt er 1925 ins Reichswirtschaftsministerium, wo er im Kartellreferat eingesetzt ist, der Bereich, der für seine weitere wissenschaftliche und politische Arbeit prägend sein wird.
Moral als Kategorie in der Ökonomie
Der Widerstand gegen das NS-Regime führt Franz Böhm und Walter Eucken zusammen in der Gegnerschaft zur Hochschulpolitik Martin Heideggers in Freiburg, er bringt sie und andere Wissenschaftler, die später der „Freiburger Kreis“ genannt werden, aber auch in Kontakt zum „Kreisauer Kreis“ um Helmut James Graf von Moltke. In deren Auftrag erarbeitet Böhm mit Anderen Grundzüge für eine Wirtschaftspolitik nach der NS-Diktatur. Ihn interessiert auf der Grundlage der Thesen, die bereits Gegenstand seiner früheren Wissenschaft und seiner Habilitationsschrift sind, die Frage, in welchem Verhältnis Recht und Macht zueinander zu stehen haben. Böhm begreift Moral dabei nicht als teilbar in einen persönlichen und politischen Bereich, sondern als Einheit. Daher sei die Wirtschaft in ihren Prozessen zwar grundsätzlich frei, sie habe sich aber an die Vorgaben zu halten, die der Gesetzgeber in seinem Regelwerk definiere.
Moral als Kategorie in der Ökonomie, ein Punkt, den Jahre zuvor schon Nell-Breuning markiert – der Konflikt Böhms mit der Ideologie der Nationalsozialisten ist so quasi vorprogrammiert. Zwar erhält er 1936 einen Ruf an die Universität Jena mit der zunächst begründeten Erwartung, dort zum Ordinarius berufen zu werden. Die Schwierigkeiten mit dem Regime lassen jedoch nicht lange auf sich warten.
Eine Denunziation wegen „judenfreundlicher Äußerungen“ bringt Franz Böhm in die Fänge der Justiz; das Verfahren endet 1938 mit dem Entzug der Lehrbefugnis. In einem längeren, letztlich sogar zu seinen Gunsten entschiedenen Rechtsstreit kämpft er zwar für seine Lehrtätigkeit; das Reichserziehungsministerium bestätigt ungeachtet dessen den Entzug der venia legendi. Im Kontext des Attentats vom 20. Juli 1944 wird Böhm zwar verhaftet und verhört; allein eine schlichte Verwechslung ist ursächlich dafür, dass er seine Kontakte und Aktivitäten nicht mit den Leben bezahlt.
Verhandlungen über Wiedergutmachung mit Israel
Ab 1948 lehrt er als Rektor der Universität Frankfurt. In das wirtschaftswissenschaftliche Jahrbuch „Ordo“, das Böhm zusammen mit Walter Eucken 1948 aus der Taufe hebt, fließen jene Gedanken ein, die die Freiburger Schule bereits während der NS-Zeit als Grundzüge für eine Wirtschaftspolitik der Nachkriegszeit entworfen hatte; allerdings ergänzt um theologische Aspekte, die (mit den Worten Alfred Müller-Armacks) das Ziel verfolgen, ein Analogon zur katholischen Soziallehre zu entwickeln, das, wie diese, auf dem Naturrecht beruht. Beredtes Zeichen hierfür ist der Artikel 28 des Grundgesetzes, der entlang des Prinzips der Subsidiarität die Selbstverwaltung der Gemeinden formuliert und ihnen das Recht auf eine eigene Steuerquelle nebst Hebesatzrecht zuspricht.
Zwischen 1953 und 1965 gehört Franz Böhm dem Deutschen Bundestag an. Dort bildet er insbesondere in der politisch umstrittenen Frage nach Kartellrecht und Kartellbehörde den parlamentarischen Flankenschutz für Ludwig Erhard. Erhard selbst berichtet in „Wohlstand für alle“ ausführlich über die harten Auseinandersetzungen zu diesen Themen. Historische Verdienste erwirbt sich Böhm aber auch auf einem anderen Gebiet: Als Mitbegründer der „Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit“ wird er an die Spitze der Delegation berufen, die mit Israel die Verhandlungen über Wiedergutmachung führt.
Die Printausgabe der Tagespost vervollständigt aktuelle Nachrichten auf die-tagespost.de mit Hintergründen und Analysen. Kostenlos erhalten Sie die aktuelle Ausgabe