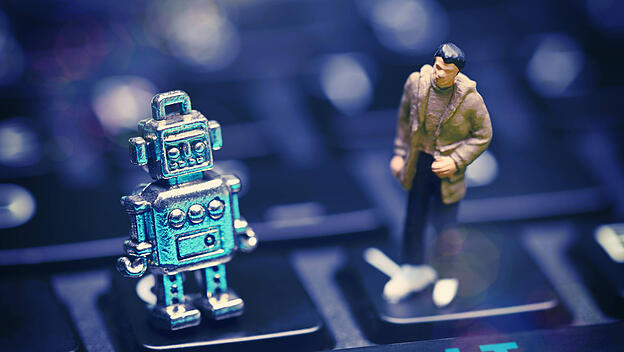Bereits 2014 warnte der Astrophysiker Stephen Hawking vor einer Künstlichen Intelligenz, die die Menschen überwinden könnte. Zum Glück für uns sind wir derzeit technisch noch nicht in der Lage etwas zu bauen, das genügend Kapazität dazu hätte. Dennoch gilt es, sich mit der Frage zu befassen, was eine KI (Künstliche Intelligenz) ist und warum kaum eine technische Entwicklung so viele Ängste auslöst.
Der Schöpfer dieses Begriffs ist der amerikanische Logiker und Informatiker John McCarthy. In einem Förderantrag für eine Konferenz fand sich erstmals der englische Begriff "artifical intelligence" im Titel der geplanten Veranstaltung.
Ein erstes Problem ergibt sich bei der Frage, was Intelligenz ist. Diskussionen um die Frage, ob Empathie ein Kriterium für Intelligenz ist, zeigen das Problem. Gehören der EQ (Wert für emotionale Fähigkeiten) und der IQ zusammen oder sind sie Rivalen? Je nach Schule unterscheidet man sieben oder acht Intelligenzen. Eine Studie an der Harvard-Universität hat räumliche, körperlich-kinästhetische, musikalische, linguistische, logisch-mathematische, zwischenmenschliche, intrapersonelle und naturalistische Intelligenz identifiziert und beschrieben. Macht man sich bewusst, dass der klassische IQ-Test gerade drei der oben angegebenen Formen misst, nämlich die sprachliche, die logisch-mathematische und die räumliche Intelligenz, erkennt man schnell, wie defizitär unser Intelligenzbegriff ist.

Menschliche Intelligenz
Können wir menschliche Intelligenz in ihrer Fülle kaum erfassen, so wird es bei maschinellen Systemen noch schwerer. Der anarchistische Denker und Linguist Noam Chomsky spricht sogar von der Dummheit künstlicher Intelligenz und begründet dies mit dem unterschiedlichen Lernen von Mensch und Maschine. Zu Anfang des Jahres verpasste der 94-jährige Intellektuelle dem Hype um Chat-GPT in einem Artikel in der New York Times einen Dämpfer. Während die Welt ehrfürchtig erstarrt auf den künstlich-intelligenten Textgenerator und seine durchaus beeindruckenden Ergüsse blickte, demaskierte Chomsky die Maschine mit wenigen Worten.
"Der menschliche Verstand ist ein überraschend
effizientes System."
In Anlehnung an Wilhelm von Humboldt baute der Linguist den Gegensatz auf, dass der Mensch "unendlichen Gebrauch von endlichen Mitteln" machen könne, die Maschine aber nur aus Unmengen an Daten zusammenfüge, was ihrem Algorithmus plausibel erscheine. Den größten Unterschied zwischen Mensch und Maschine bringt Chomsky so ins Wort: "Der menschliche Verstand ist ein überraschend effizientes und sogar elegantes System, das mit kleinen Informationsmengen arbeitet; es versucht nicht, grobe Korrelationen zwischen Datenpunkten abzuleiten, sondern Erklärungen zu schaffen."
Ist das Intelligenz oder kann das Intelligenz nur simulieren? Zwei sich widersprechende Testverfahren decken ein Dilemma auf. Der Touring-Test besagt, wenn ein Mensch mit einer Maschine interagiert und dabei im Blindversuch zu der Überzeugung kommt, mit einem Menschen zu interagieren, liegt künstliche Intelligenz vor. Der Versuch "Das chinesische Zimmer" dagegen illustriert, wie leicht man sich täuschen kann. Ein Mensch gibt Zettel mit chinesischen Schriftzeichen durch einen Briefkastenschlitz in einen Raum. Es kommen Zettel mit perfekten Antworten zurück. Der Mensch im Innern kann aber gar kein Chinesisch, er hat nur sehr exakte Anweisungen, wie er auf welche Schriftzeichen reagieren muss. Sagt ein bestandener Touring-Test nun etwas über die Intelligenz einer Maschine oder über die Qualität ihrer Programmierung?
Erfolgreiche KI
Was ist eine erfolgreiche KI? Was ist eine gute KI? Diese und andere Fragen stellt sich Vincent C. Müller, Alexander-von-Humboldt-Professor für Ethik und Philosophie der KI an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. Der Philosoph ist ein Grenzgänger zwischen Philosophie und Technologie. Im Video, das die Alexander von Humboldt-Stiftung auf YouTube veröffentlicht hat, spricht er über den komplexen Zusammenhang von KI und Ethik. Eine entscheidende Frage sei, so Müller, ob eine technisch erfolgreiche KI und eine gute KI dasselbe seien. "Die Antwort ist klarerweise: Nein. Das ist das Problem der KI-Ethik."
Man versuche, fährt der Wissenschaftler im Video fort, auf eine Linie zu bringen, was technisch gemacht werde und was gesellschaftlich sinnvoll sei. Den Menschen sieht Müller als Inspiration für die KI. Zu verstehen, wie Menschen Probleme lösen, könne helfen, KI erfolgreicher zu gestalten. Auch die umgekehrte Frage stellt der Wissenschaftler, nämlich wie sich KI auf den Menschen auswirke. Technologische Entwicklungen, so die Ansicht des Philosophen, würden den Menschen auf unterschiedliche Weise verändern. "Sie beeinflussen unser Selbstbild und unsere Art zu denken", so Müller. Auch Ängste vor dieser Technologie haben in der Forschung des Philosophen ihren Ort.
"KI folgt allein
mathematischen Formeln."
Warum uns KI stärker berühre als andere Technologien, erklärt Müller so: Eine gewisse Angst vor der KI sei nicht nur verständlich, sondern auch rational begründet. Wir sollten uns Sorgen darüber machen, was das mit unserer Gesellschaft macht. "Bei der KI kommt noch ein besonderer Aspekt hinzu, nämlich dass die KI genau das betrifft, was uns besonders macht: die menschliche Intelligenz. Plötzlich kommt eine Technologie, die genau unsere zentrale Eigenschaft auch hat, vielleicht sogar noch mehr als wir." Dass dies als Bedrohung empfunden wird und die Menschen beunruhigt sein sollten, ist für Vincent C. Müller klar. Er nennt als Ausweg, um diesen Sorgen entgegenzuwirken und eine humane KI zu fördern, die Notwendigkeit von Transparenz, Kontrolle und einem klaren ethischen Kompass.
Eine neue Kultur
Um eine klare Einordnung dieser Technologie bemühen sich auch Theologen. Der Kölner Theologe und Sozialethiker Elmar Nass sprach dazu auf der Internetseite des Erzbistums Köln. Die technologische Filterbubble hat das Thema längst verlassen und dringt auf allen Ebenen in die Gesellschaft vor. Nass erklärt die KI grob so, dass sie allein Algorithmen, also mathematischen Formeln folge. Künstliche Intelligenz ist von technischer Seite her maschinelles Lernen. Damit zeigen sich die Grenzen des Intelligenzbegriffs auch hinsichtlich des von McCarthy erfundenen Begriffs "artifical intelligence". Nass schlägt an dieser Stelle gleich auch die Brücke zum Transhumanismus, wenn er davor warnt, dass KI dazu benutzt werden könnte, uns jenseits des österlichen Glaubens eine Überwindung des Todes vorzugaukeln. Damit spielt Nass unter anderem auf die sehr theoretische Möglichkeit an, den Inhalt eines Gehirns in eine KI zu speichern. Technologisch sind wir davon weit entfernt.
Auf andere technische Möglichkeiten, die derzeit schon Realität sind, weist Nass ebenfalls hin: KI stelle ärztliche Diagnosen, präge Meinungsbildung, schaffe effiziente Arbeitsprozesse, übernehme militärische Zielbestimmung von Waffen, zeige humanoide Gefühle in Robotern, entwerfe Predigttexte und sprachliche Übersetzungen oder ganze Doktorarbeiten. Elmar Nass sieht hier eine neue Kultur heraufziehen: Menschliches Entscheiden, Denken und Verhalten werde umfassend dominiert durch die vermeintliche Eindeutigkeit von Algorithmen. Er teile, so der Theologe, ausdrücklich nicht eine KI-Euphorie, mit der Gott, Mensch und Technik als drei ähnliche Wesen ineinander verschwimmen. In dem Zusammenhang spricht Nass von einer "Trinität", die letztlich Gott und Mensch den Algorithmen unterordne.
Damit erklärt der Theologe auch ganz klar, dass sich nicht unsere Vorstellungen von Gott und Menschenwürde den neuen technischen Errungenschaften anzupassen hätten. "Als Christen müssen wir vielmehr fragen, wie sich neue Technologien mit dem Schöpfungsplan Gottes, der Botschaft Jesu und der Gottesebenbildlichkeit des Menschen und seiner Verantwortung vor Gott in der Schöpfung vereinbaren lassen", so Nass. Um einen verantwortungsvollen Umgang mit KI gewährleisten zu können, fordert der Theologe und Sozialethiker eine starke Technikethik. Das erfordere internationale Schulungen über Würde, Verantwortung und Freiheit.
Dazu brauche es internationale Regeln, die eine KI-basierte Abschaffung von Würde und Demokratie verhinderten. Dazu müssten auch kulturelle Unterschiede berücksichtigt werden. In Japan etwa spreche man auch technischen Artefakten eine Seele zu. Zudem müssten Regime wie China mit einbezogen werden, die eine "KI-gestützte Gleichschaltung der Menschen" anstreben.
Augenmaß behalten
Zwischen den Warnungen von Stephen Hawking und anderen Denkern, die zuweilen die KI schon mal als letzte Erfindung der Menschheit bezeichnen, und den nüchternen Geistern öffnet sich für die Beurteilung dieser Technologie eine große Spannbreite. Es gilt, sich den ethischen Herausforderungen durch die KI zu stellen. Die Technologie ist da und wird nicht wieder gehen. Chancen und Bedrohungen durch Künstliche Intelligenz sind vorhanden, die Entwicklung ist rasant. Darum ist eine tragfähige ethische Basis weitaus wichtiger als Gesetze, die von der technischen Entwicklung permanent überholt werden können.
Die Printausgabe der Tagespost vervollständigt aktuelle Nachrichten auf die-tagespost.de mit Hintergründen und Analysen.