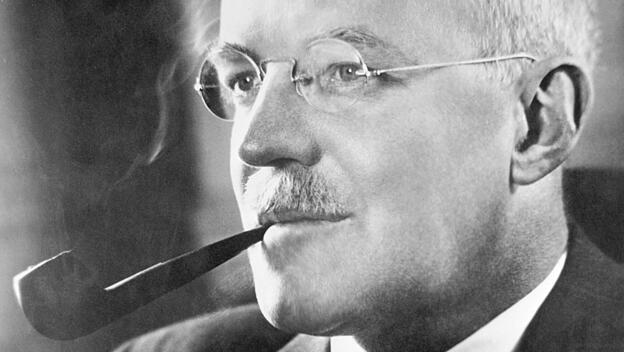George Clooney war bis aufs Mark erschüttert: Als der berühmte Hollywood-Schauspieler bei einer von ihm persönlich ausgerichteten Wahlkampf-Spendengala im Juni 2024 Joe Biden begrüßte, schien der damalige US-Präsident den Gastgeber offenbar nicht zu erkennen. „Danke, dass Sie da sind“, sagte er wiederholt zu Clooney, der als Freund und Unterstützer Bidens galt. Er kenne doch George, half ihm ein Assistent auf die Sprünge. „Ja, ja“, antwortete Biden. „George Clooney“, präzisierte der Assistent. „Aber natürlich! Hi, George“, erwiderte Biden daraufhin. Für alle Umstehenden war offensichtlich, dass Biden nicht wusste, wer Clooney war.
So schildern die Journalisten Jake Tapper und Alex Thompson den Austausch zwischen Biden und Clooney in „Hybris. Verfall, Vertuschung und Joe Bidens verhängnisvolle Entscheidung“. Szenen jener Art gibt es viele in dem jüngst erschienenen Buch, das offenbart, wie dramatisch es tatsächlich um Bidens Gesundheit stand. Und das nicht erst in den Monaten vor seinem Rückzug von der abermaligen Präsidentschaftskandidatur. Die Autoren, die für die eher linken Medien CNN und Axios arbeiten, haben mit zahlreichen, meist anonym bleibenden Personen aus dem unmittelbaren Umfeld des Ex-Präsidenten gesprochen. Die Kernthese: Ein eingeschworener inneren Zirkel aus Bidens engsten Vertrauten, der sich selbst in ironischer, aber treffender Anlehnung an Sowjetzeiten „Politbüro“ nannte, habe mit aller Macht darum gekämpft, dass der Demokrat eine zweite Amtszeit bestreitet. Dessen zunehmenden Verfall habe man vor Medien und Öffentlichkeit gezielt zu verbergen versucht. Zu diesem Zirkel von Vertrauten gehörten unter anderen die Politik-Veteranen Mike Donilon, Steve Richetti und Bruce Reed.
Was müssen die Bürger über die Gesundheit des Präsidenten wissen?
Die Enthüllungsprosa Tappers und Thompsons ist stellenweise zwar effekthascherisch. Was sie schildern, wirkt jedoch grundsätzlich glaubwürdig. Die Autoren hatten sogar Zugang zum Kabinett des ehemaligen Präsidenten. Und sie stammen aus einem den Demokraten nahestehenden linksliberalen Lager, dürften also kein Interesse daran haben, Biden grundlos in die Pfanne zu hauen. Zudem waren die meisten Versprecher, Pannen und Gedächtnislücken des inzwischen 82-jährigen Biden öffentlich bekannt. Auf der Plattform YouTube gibt es stundenlange Zusammenschnitte davon.
Die Grundfragen, mit denen sich die US-Journalisten auseinandersetzen: Was sollte, was muss das amerikanische Wahlvolk über die Gesundheit seines Präsidenten wissen? Und wie konnte ein Kreis enger Vertrauter den offensichtlich rapiden kognitiven Verfall Bidens so lange abstreiten, bis es schließlich zu spät war?
Mehrere Aspekte gilt es zu beleuchten: Die Behauptung, Biden sei nicht mehr in der Lage, die Geschicke des Landes für weitere vier Jahre zu lenken, wurde von seinen Verteidigern oft mit dem Argument abgetan, es sei würdelos und tue dem damaligen Präsidenten unrecht, ihn auf sein fortgeschrittenes Alter zu reduzieren. Ja, Biden sei alt, und das merke man ihm auch an. Doch es sei Altersdiskriminierung, wenn man ihm, dem erfahrenen Politiker, der schon so einige Schlachten geschlagen, zahlreiche Rückschläge weggesteckt habe, deshalb grundsätzlich die Eignung für das Präsidentenamt abspreche.
Wenn Biden auftrat, wurde nichts dem Zufall überlassen
Und in der Tat: Biden wurde im Laufe seines langen Lebens immer wieder vom Schicksal schwer geprüft. Er verlor schon in jungen Jahren seine Ehefrau und die kleine Tochter bei einem Autounfall. In den 1980ern wäre er beinahe an einem Aneurysma gestorben. 2015 erlag sein Sohn Beau, in dem alle Bidens politischen Nachfolger sahen, einem Hirntumor. Und auch sein verbliebener Sohn Hunter machte immer wieder Schwierigkeiten: Alkohol- und Drogenmissbrauch, Steuerhinterziehung und der Vorwurf dubioser Geschäftstätigkeiten zerrten ihn immer wieder in den Fokus der Öffentlichkeit. 2024 wurde er sogar gerichtlich verurteilt. All das zehrte an Biden und warf ihn mental aus der Bahn.
Erschwerend hinzu kommt die Tatsache, dass Biden mit Donald Trump auf einen Gegenspieler traf, der es geradezu perfektioniert hatte, die geringste Schwäche seiner Kontrahenten schamlos auszunutzen – und genau damit erfolgreich zu sein. Seit er 2015 die große politische Bühne betrat, war es Trumps Strategie, weniger auf der sachlichen und stattdessen auf der persönlichen Ebene anzugreifen, zu beleidigen und zu diskreditieren. Und Biden lieferte Trump mehr als genug Angriffsfläche. Je mehr der Republikaner und sein Umfeld daran feilten, Biden als alten, unfähigen Tattergreis darzustellen, desto stärker wurden die Abwehrreflexe des „Politbüros“. Biden selbst schirmte man immer mehr ab, um Trump nicht noch mehr Stoff zu liefern. Seine öffentlichen Auftritte wurden im Laufe seiner Amtszeit seltener, seine Ansprachen kürzer, selbst für kleinste Reden kam der Teleprompter zum Einsatz. Wenn man Biden sah, so schreiben Tapper und Thompson, kam es einer exakt geskripteten Choreografie gleich, bei der kaum etwas dem Zufall überlassen wurde.
Nun kennt die amerikanische Geschichte zahlreiche Präzedenzfälle, in denen die Öffentlichkeit nicht über ernste Erkrankungen und Leiden eines amtierenden Präsidenten aufgeklärt wurde. Allein im 20. Jahrhundert trifft dies beispielsweise auf Woodrow Wilson, Franklin D. Roosevelt oder John F. Kennedy zu. Doch auch wenn Bidens körperliche Gebrechlichkeit zeitweise so gravierend gewesen sein muss, dass sein Stab ernsthaft darüber nachdachte, ob der Präsident nicht besser einen Rollstuhl verwenden sollte: Im Vergleich mit den historischen Vorgängern gibt es einen fundamentalen Unterschied. Biden war nicht nur körperlich, sondern vor allem geistig zunehmend ein Schatten seines früheren Selbst. Seine engsten Vertrauten wussten irgendwann im Jahr 2023: Vier bis sechs Stunden in der Tagesmitte – länger konnte man dem Präsidenten keine geistig fordernde Arbeit zumuten.
Biden erfüllte nicht mehr die Voraussetzungen für das Präsidentenamt
Spätestens zu diesem Zeitpunkt hätte allen Beteiligten klar sein müssen: Biden erfüllte nicht mehr die Voraussetzungen für das strapaziöse Präsidentenamt, geschweige denn für weitere vier Jahre. Doch den Gedanken, dass die Bürger einen Anspruch darauf haben, zu wissen, wen sie mit ihrer Stimme wählen, anstatt hinters Licht geführt zu werden, ließ Bidens engstes Umfeld nicht zu. Gerade in Zeiten, in denen viele Wähler von der Politik frustriert sind und das Gefühl haben, von abgehobenen Eliten beherrscht zu werden, sendet das Vorgehen in Bidens Lager ein fatales Signal. Es bestätigt genau die Vorurteile, die Trump stark gemacht haben.
Wer ist schon stets objektiv sich selbst gegenüber? Dass Joe Biden nicht erkannte, nicht erkennen wollte, dass ein selbstbestimmter Abtritt mit Würde die bessere Entscheidung gewesen wäre – für das Land, für sein Erbe –, kann man ihm vielleicht gar nicht vorwerfen. Doch hatte er genügend intelligente Leute in seiner Familie, in seinem engsten Beraterkreis, die ihm den Rückzug hätten nahelegen müssen. Dass dies nicht geschah, darin liegt die Hybris, wie es im deutschen Buchtitel heißt. Im Titel des Originals ist sogar von der „Ursünde“ die Rede, die darin bestanden habe, dass Bidens Kandidatur zur Wiederwahl nicht hinterfragt wurde.
Ist diese religiöse Konnotation überzogen? Vielleicht. Doch sie ist nicht ohne Grund gewählt. Die Autoren schildern, dass sich um den ehemaligen Präsidenten eine regelrechte „Theologie“ aufgebaut habe, zu der eine quasi kulthafte Treue zum Anführer gehörte. Und der Glaube, dass es Biden schon irgendwie schaffen werde, wie so oft in seiner langen Laufbahn. Das Dogma der „Biden-Theologie“: Nur er könne Trump schlagen. Schließlich habe er das schon einmal bewiesen. Bidens Vizepräsidentin Kamala Harris traute man das Duell mit Trump dagegen nicht zu. Trete sie an, bedeute das den sicheren Sieg für Trump, so die These.
Täuschung des amerikanischen Volkes
Eine derartige Täuschungskampagne, wie sie das selbsternannte „Politbüro“ aufzog, hat das amerikanische Volk nicht verdient. Doch um das Volk, so schließen die Autoren Tapper und Thompson, sei es dabei gar nicht gegangen – sondern um einzelne Leute in Bidens Team, die an ihrem Amt, ihrer Macht und ihren Privilegien klebten. Indem sie die Wahrheit zurechtbogen, ignorierten und teilweise einfach logen, handelten sie kaum besser als Trump. Dass sie damit die Partei – und womöglich auch das ganze Land – langfristig in eine schwere Krise gestürzt haben, wird im Nachhinein immer klarer.
Die Printausgabe der Tagespost vervollständigt aktuelle Nachrichten auf die-tagespost.de mit Hintergründen und Analysen.