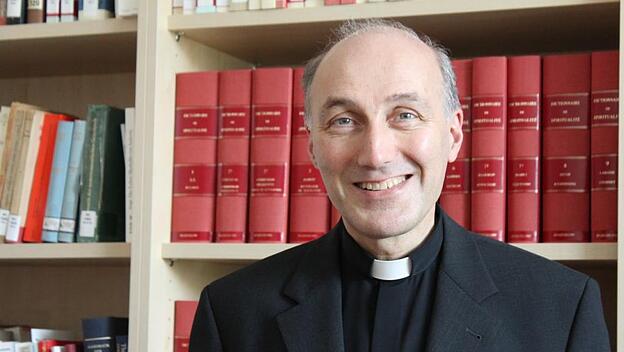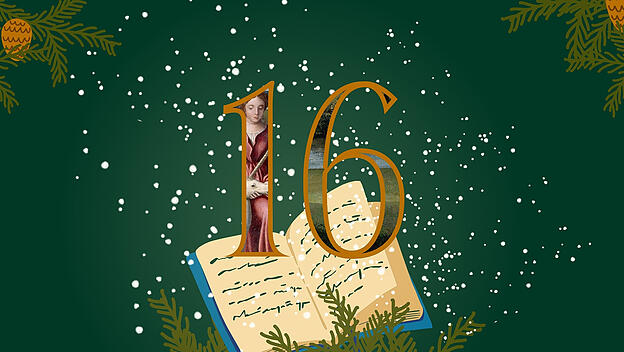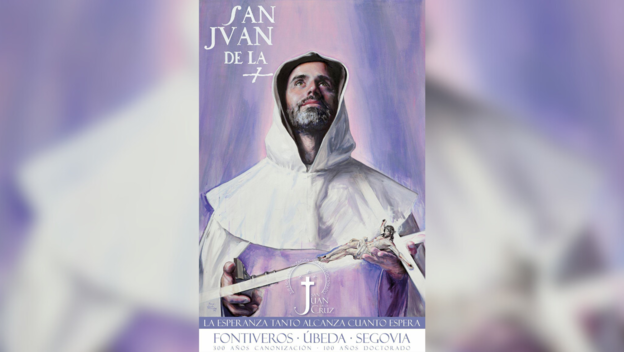Was passiert, wenn Abschiednehmen zur Geschmackssache und selbst der Tod zum Ausdruck von Individualität wird? Die Zahl der katholischen Bestattungen in Deutschland nimmt seit Jahren stetig ab. Waren es 2021 noch rund 240 000 Begräbnisse im katholischen Ritus, ist die Zahl im Jahr 2024 auf ungefähr 213 000 gesunken. Dies entspricht einem Rückgang von circa elf Prozent. Bei den Protestanten sieht es nicht viel besser aus. Schließlich sind die kirchlichen Begräbnisse in der Bundesrepublik laut einer Erhebung der Verbraucherinitiative Aeternitas im Jahr 2020 zum ersten Mal unter die 50-Prozent-Marke gesunken. Diese Zahlen deuten darauf hin, dass sich die Art und Weise, wie Menschen von Angehörigen, Freunden und Bekannten Abschied nehmen, grundlegend verändert hat.
Auf diesen Wandel reagiert mancherorts auch die Politik. Im September wurde in Rheinland-Pfalz das liberalste Bestattungsgesetz der Bundesrepublik beschlossen. Zukünftig wird es beispielsweise keine Sargpflicht mehr geben und der Friedhofszwang wird weitgehend aufgehoben. Laut dem sozialdemokratischen Gesundheitsminister Clemens Hoch sei hiermit ein neuer Rahmen geschaffen worden, „der individuelle Vorstellungen und Wünsche der Menschen im Land mit einem würdevollen Abschiednehmen in Einklang bringt.“ Ob andere Bundesländer nachziehen werden, wird sich zeigen. Laut Burkhard Kämper, dem Justitiar des Katholischen Büros NRW, gebe es in seinem Bundesland derzeit keine Diskussion um die Lockerung bestehender Bestattungsvorschriften.
Deutliche Verschiebung zur Feuerbestattung
Wie genau werden Verstorbene heute beigesetzt und welche Ursachen hat der Wandel im Umgang mit dem Tod? Was die derzeitige Praxis der Bestattung angeht, beobachtet das in München ansässige Bestattungsinstitut TrauerHilfe DENK seit Jahren eine deutliche Verschiebung von der Erdbestattung hin zur Feuerbestattung. Laut Angaben des Unternehmens erfolgen inzwischen ungefähr 70 Prozent der Beisetzungen als Urnenbestattung. Womit sich auch im Raum Bayern ein Trend abzeichne, der überregional zu beobachten sei. Vor allem in den Städten nehmen Erdbestattungen ab. Auf dem Land werden diese zwar noch gepflegt, jedoch sei auch dort ein Rückgang zu beobachten. Gründe hierfür seien höhere Kosten für das Grab sowie mehr Aufwand für die Grabpflege. Viele Angehörige würden sich Grabformen wünschen, die pflegeleicht sowie naturnah sind und sich persönlich gestalten lassen.
Geld ist also ein Faktor für den Wandel, jedoch nicht der einzige. Das beobachtet auch das Bestattungsinstitut TrauerHilfe DENK: Bei den Trauerfeierlichkeiten spiele der ökonomische Aspekt zwar eine wachsende Rolle, sei aber nicht das alleinige Kriterium für die Wahl einer Alternative. Entscheidend sei eine Feier, welche die Erinnerung an den Verstorbenen bewahre. Auch der Nachhaltigkeitsgedanke sei ein Grund, warum andere Formen der Bestattung wie die Baum- und Naturbestattung besonders gefragt seien: „Viele Angehörige möchten einen Abschied, der nicht nur naturnah, sondern auch ökologisch verantwortungsvoll ist.“
Der Trend hin zu alternativen Bestattungsformen bleibt auch der Kirche nicht verborgen. Dies zeigt sich auch daran, dass bereits mehrere Gotteshäuser in Kolumbarien umgewandelt wurden. Dieses Schicksal soll beispielsweise auch die Kirche St. Franziskus in Osnabrück ereilen. Aus der Sicht des Katholischen Büros NRW sind diese akzeptabel, solange der Verstorbene identifizierbar bleibt. Einen Bestattungszwang hält Kämper für notwendig, „um einen würdigen Umgang mit den sterblichen Überresten zu gewährleisten.“ Eine Aufbewahrung der Überreste eines Menschen in Privaträumen sei inakzeptabel, da hierdurch verhindert werden könnte, dass Familienangehörige oder Freunde die letzte Ruhestätte als Ort ihrer Trauer aufsuchen. Mit dem Rückgang der Mitgliederzahlen gehe zugleich die Nachfrage nach kirchlichen Begräbnissen deutlich zurück. Bitter sei jedoch, „dass auch Menschen, die in der Kirche sind, eine weltliche Begräbnisform wählen.“
Auch das Bestattungsinstitut TrauerHilfe DENK beobachtet, dass der schwindende religiöse Bezug das Abschiednehmen verändert. Laut diesem verliere gerade in Großstädten die religiöse Bindung an Bedeutung. „Während früher fast jede Trauerfeier kirchlich begleitet wurde, wählen heute viele Angehörige eine freie oder konfessionsunabhängige Zeremonie, meist mit einem freien Redner oder einer individuell gestalteten Abschiedsfeier nach eigenen Wünschen“, erklärt das Bestattungsunternehmen. In Regionen wie Nieder- und Oberbayern, in denen der katholische Glaube tief verwurzelt sei, blieben die kirchlichen Trauerfeiern häufiger erhalten. In Städten wie Ingolstadt oder München beobachtet TrauerHilfe DENK hingegen deutlich mehr freie Trauerfeiern, Einäscherungen und alternative Bestattungsformen.
Warum sich Angehörige für eine freie Trauerfeier entscheiden, weiß Thomas Kirsch. Er ist ehemaliger Pfarrer, der laut eigenen Angaben aufgrund des Zölibats aus dem Dienst ausgeschieden ist. Gerade wegen seines Hintergrundes würden viele Angehörige bewusst auf ihn zukommen. Bei den von Kirsch auf ihrem letzten Weg begleiteten Verstorbenen handele es sich um Personen, die entweder noch in einer Kirche oder bereits aus dieser ausgetreten sind. Deren Familien würden sich eine Trauerfeier mit „christlichen Elementen“ wie dem Wunsch nach einem Weiterleben bei Gott oder ein Gebet wie das Vaterunser wünschen. Die Gründe für eine Entscheidung gegen ein kirchliches Begräbnis seien, dass sie den Pfarrer der Gemeinde nicht kennen oder eine grundsätzliche Enttäuschung über die Struktur der Kirche. Hinzu komme, dass sich manche Kirchenvertreter zu wenig Zeit nähmen und „manchmal nur wenig auf die Person des Hinterbliebenen eingehen.“
Andere Arten der Bestattung gibt es jedoch auch im Kontext von anderen Religionen. So hat das Bestattungsunternehmen TrauerHilfe DENK in den vergangenen Jahren Beisetzungen nach islamischem Ritus begleitet. Diese finden ohne Sarg statt. Der Verstorbene wird in weiße Leinentücher gehüllt und auf der rechten Seite liegend mit dem Gesicht in Richtung Mekka bestattet.
Digitalisierung prägt Abschiednehmen
Zusätzlich beobachtet das Münchner Bestattungsinstitut, dass die Digitalisierung die Art des Abschiednehmens und Gedenkens zunehmend prägt. Formate wie Online-Gedenkseiten und Livestreams würden an Bedeutung gewinnen und sich immer mehr als Bestandteil der Trauerkultur etablieren. Besonders Familien mit Angehörigen im Ausland würden Onlineportale immer stärker für Beileidsbekundungen, Bilder, Erinnerungen und Spenden nutzen. Auch die Nachfrage nach Übertragungen von Trauerfeiern im Internet habe sich erhöht. Zunächst bedingt durch die Einschränkungen in der Corona-Zeit, nun aber auch als Möglichkeit zur Anteilnahme von Angehörigen, die nicht anreisen können.
Der Wandel in der Bestattungskultur spiegelt sich auch im Umgang mit der Trauer selbst wider. Die Zeitgeistforscherin Kirstine Fratz beobachtet viele individualistische und wenig institutionelle Impulse für den Umgang mit Lebenswelten – von der Familie über den Sport bis zum Tod. „Die Trauerzeit ist in unserer Kultur ein Stiefkind“, stellt sie fest und verweist auf die Gesetzgebung: Eltern, die ein Kind verlieren, haben Anspruch auf zwei Tage Sonderurlaub, stirbt der Lebenspartner oder ein Elternteil, bleibt nur ein zusätzlicher Tag. „Das spricht Bände: Trauern hat uns nicht vom Funktionieren abzuhalten.“ Das, so die in Hamburg tätige Unternehmerin, sei im christlichen Kontext noch anders, allerdings sei Trauern dort auch ein sehr normierter Prozess: Trauerjahr und Konventionen – „das würde heute keiner mehr mitmachen“.
In der alternativen Trauerkultur fällt ihr vor allem die Entwicklung in der Trauerbegleitung auf. Projekte wie „Trosthelden“ für Menschen in Trauerprozessen werden sehr gut angenommen – auch von trauernden Männern. Der Zeitgeist fördert ein kollektives Unterstützernetzwerk. An persönliche Erfahrungen nach dem Tod ihrer hochbetagten Mutter, einer Atheistin, beschreibt sie als Neuland:
„Ich bin in Trauerphasen hineingeraten, auf die ich nicht vorbereitet war und von denen ich noch nie gehört hatte.“ Trauern sei ein blinder Fleck und koste Kraft. Man trauere nicht um die Person, sondern um die Beziehung zu ihr – letztlich um sich selbst. Für Kirstine Fratz, die keine Christin ist, war der Austausch mit anderen wichtig. Der Zeitgeist befähige heute Menschen, sich der Trauerarbeit in einem sehr individuellen, tiefsinnigen und nicht normierten Prozess anzunehmen: „Sonst ist man mit der Trauer sehr allein.“
Die Printausgabe der Tagespost vervollständigt aktuelle Nachrichten auf die-tagespost.de mit Hintergründen und Analysen.