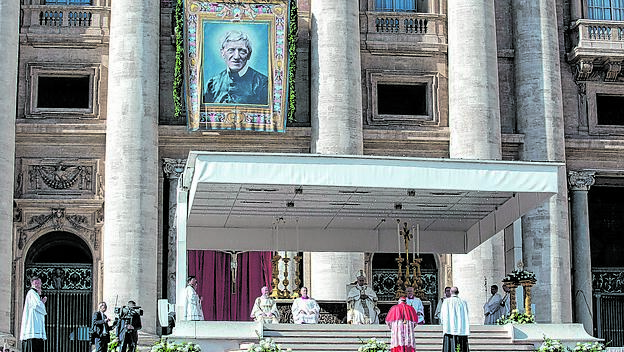In einem Interview mit der Vatikanjournalistin Diane Montagna, dessen vollständigen Wortlaut sie auf ihrer Plattform „dianemontagna.substack.com“ veröffentlicht hat, geht der Präfekt des vatikanischen Dikasteriums für die Glaubenslehre auf den Sinn einer Passage in der lehrmäßigen Note „Mater Populi Fidelis“ vom 7. Oktober ein – einer Passage, die erhebliche Aufregung in kirchlichen Kreisen hervorgerufen hat.
Auslöser der Debatte bildete die Formulierung der Note, wonach der Titel „Miterlöserin“ „immer unangebracht“ sei, wenn es um die Definition von Marias Mitwirkung an der Erlösung gehe. Der Präfekt präzisiert nun, dass dieses „immer“ allein auf die Zukunft bezogen ist. Der Begriff dürfe künftig lediglich nicht mehr in offiziellen Dokumenten oder liturgischen Texten vorkommen.
Papst Johannes Paul II., so der Kardinal, habe den Ausdruck eine Zeit lang selbst gebraucht, ihn jedoch nach theologischen Prüfungen nicht mehr verwendet. Genau hier setze die Note an: Bestimmte inhaltliche Aspekte des Begriffs bleiben theologisch gültig, doch erzeuge der Ausdruck heute pastorale Missverständnisse. Es handle sich also um eine Präzisierung des Vokabulars in Lehramtstexten und Liturgie, nicht um ein nachträgliches Urteil über frühere Äußerungen von Heiligen, Kirchenlehrern oder Päpsten, die den Begriff verwendet haben.
Privat weiter erlaubt
Fernández unterstreicht, dass der Titel in der privaten Frömmigkeit weiterhin erlaubt ist: Gläubige können ihn in Gebetsgruppen oder persönlichen Andachten nutzen, vorausgesetzt, es bleibt klar, dass Maria dem Erlösungswerk Christi vollständig untergeordnet ist. Entscheidend sei die Vermeidung von Missverständnissen, die den Eindruck einer Konkurrenz zu Christus erwecken könnten.
Die lehrmäßige Note hat in der weltweiten Kirche lebhafte Diskussionen entfacht. Kritiker werfen ihr vor, die „einzigartige Mitwirkung“ Mariens weniger stark zu betonen, als Fernández es darstellt. Pater Salvatore Maria Perrella, Professor an der Päpstlichen Theologischen Fakultät Marianum in Rom und Vorstandsmitglied der Internationalen Marianischen Päpstlichen Akademie, bemängelt, das Dokument vernachlässige wichtige trinitarische und symbolische Dimensionen und gewichte christologische und ekklesiologische Aspekte unausgewogen. Dennoch räumt er ein, dass marianische Lehrentwicklung stets von intensiver Forschung und offenen Debatten geprägt gewesen sei – und dass auch kontroverse Texte fruchtbare theologische Auseinandersetzungen anstoßen könnten.
Waren Mariologen eingebunden? Fernández sagt ja
Pater Maurizio Gronchi, Christologe und Berater des Dikasteriums, warnt davor, dass eine unreflektierte Verwendung der Titel „Miterlöserin“ oder „Mittlerin“ zu einer verzerrten Glaubensvorstellung führen könnte. Die Idee etwa, Maria müsse Gott zur Barmherzigkeit bewegen, stehe im Widerspruch zum biblischen Gottesbild. Gleichzeitig deutet er eine Besonderheit im Entstehungsprozess des Dokuments an: Anders als üblich seien kaum Mariologen aus renommierten Fachinstitutionen involviert gewesen. Weder Vertreter der Theologischen Fakultät Marianum noch der Päpstlichen Internationalen Marianischen Akademie hätten an der Vorstellung des Dokuments teilgenommen – ein „Schweigen“, das, wie Gronchi andeutet, als stiller Dissens interpretiert werden könnte. Kardinal Fernández hingegen betont gegenüber Montagna, es seien „sehr viele“ Mariologen und Christologen konsultiert worden.
Im Kern des Dokuments gehe es, so der Präfekt, nicht darum, Marias besondere Mitwirkung am Heilswerk zu leugnen, sondern um eine klarere Ausdrucksweise. Der Titel „Miterlöserin“ könne die „einzigartige Heilsvermittlung Christi verschleiern“ und ein „Ungleichgewicht in der Harmonie der Glaubenswahrheiten“ erzeugen. Wenn ein Begriff dauerhaft erläuterungsbedürftig bleibe, eigne er sich kaum für die Verkündigung. Es handle sich daher vor allem um eine pastorale Entscheidung: Der Glaube solle verständlich vermittelt und zugleich vor Fehlinterpretationen bewahrt werden. (DT/jg)
Die Printausgabe der Tagespost vervollständigt aktuelle Nachrichten auf die-tagespost.de mit Hintergründen und Analysen.