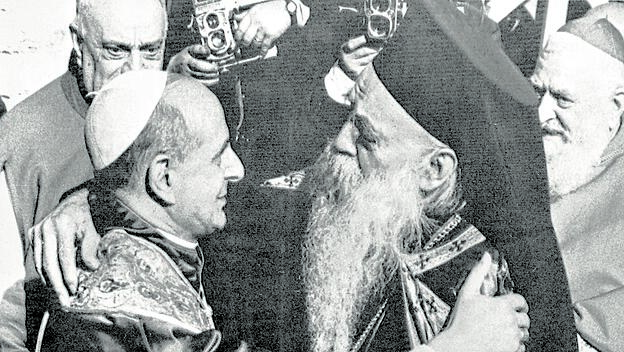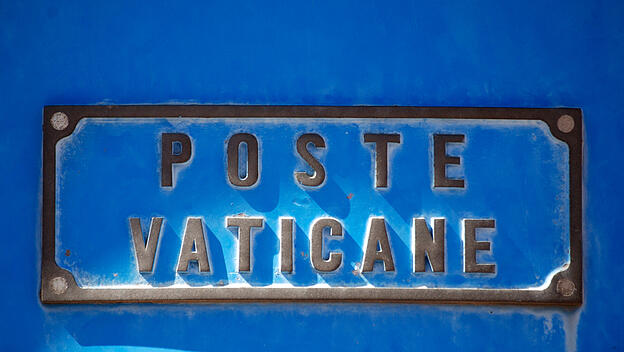Herr von Kempis, Sie haben vor kurzem ein Buch über die Geschichte des Konklaves veröffentlicht. Nun stehen wir gerade vor einer neuen Papstwahl. Petrus, der erste Papst, wurde aber gar nicht gewählt, sondern von Jesus bestimmt. Wurden die Nachfolge Petri denn schon immer gewählt und muss das so sein? Oder könnte ein Papst seinen Nachfolger auch einfach selbst ernennen?
Tatsächlich kann man Jesus Christus in Caesarea Philippi, wo er zu Petrus sagt, Du bist der Fels – auf diesem Felsen will ich meine Kirche bauen, als den ersten Papstwähler der Geschichte bezeichnen, wie das der Kirchenhistoriker Hubert Wolf getan hat. Tatsächlich wurden Päpste aber im Lauf der Jahrhunderte auf ganz unterschiedliche Art und Weise ins Amt gebracht. Es gab schon Fälle, dass ein Papst seinen Nachfolger designierte. Es gab Fälle, dass der Römische Kaiser oder der Kaiser des Heiligen Römischen Reichs Deutscher Nation nahelegte, wer Papst werden sollte. Es gab auch Fälle, wo Konstantinopel das entscheidende Placet geben musste. In der frühen Kirche aber wurde über viele Jahrhunderte der Bischof von Rom vom höheren Klerus und dem Volk, also den Christen der Stadt Rom, gewählt. Das Konklave, wie wir es heute kennen, kam erst im 13. Jahrhundert auf. Und obwohl sich jetzt das Konklave-Modell etabliert hat, könnten die Karten in Zukunft noch einmal neu gemischt werden. Denn Johannes Paul II. hat in seiner Konklave-Ordnung „Universi Dominici Gregis“ von 1996 festgestellt, dass es eigentlich ein Privileg des Papstes selbst ist, über die Art und Weise zu befinden, wie die „Ernennung“ – so schreibt er das tatsächlich – des Bischofs von Rom vor sich gehen sollte.
Wie lange kann, historisch betrachtet, ein Konklave denn dauern?
Aus der Geschichte weiß man, dass sich das enorm in die Länge ziehen kann. Das eindeutig längste Konklave war das von 1268 bis 1271 – die berühmte Papstwahl von Viterbo und in mancherlei Hinsicht das erste wirkliche Konklave, wo die Einwohner des Städtchens Viterbo vor den Toren Roms irgendwann bald die Geduld mit den Kardinälen verloren, die so gar keine Anstalten machten, endlich einen Papst zu wählen. Die Einwohner haben daraufhin die Wähler und ihre Assistenten im Bischofspalast der Stadt eingemauert, einen Teil des Daches abgedeckt und die Herren Wähler auf Wasser und Brot gesetzt. Trotzdem hat es noch eine Weile gedauert, bis schließlich eine Wahl zustande kam. Der dann gewählte Papst Gregor hat 1274 auf dem Konzil von Lyon das eigentlich der Not des Moments geschuldete Konklave-Modell zur Norm erhoben.
Was passiert eigentlich, wenn sich überhaupt keine Mehrheit ergeben will? Ist so etwas denkbar?
Denkbar ist alles, wenn man in die Kirchengeschichte blickt. Aber tatsächlich ist die Kette der Päpste nie wirklich abgerissen. Die größte Gefahr, die uns noch zeitlich am nächsten ist, ist das Konklave Anfang des 19. Jahrhunderts in Venedig. Napoleon hatte Pius VI. in die Gefangenschaft nach Frankreich geführt. Dort war der Papst, der als Pius der letzte verspottet wurde, im Exil gestorben und es war überhaupt nicht absehbar, ob irgendwo noch mal ein Konklave stattfinden könnte, weil die Kardinäle in den napoleonischen Wirren in alle Herren Länder geflüchtet waren. Es waren die Österreicher, die Venedig, das sie erst seit kurzem unter ihrer Herrschaft hatten, als Austragungsort eines neuen Konklaves anboten, nachdem Rom in die Hände der Franzosen gefallen war – natürlich auch, weil sie sich davon einen ihnen genehmen Papst erhofften. Aber tatsächlich hat derselbe österreichische König, der die Krone des Heiligen Römischen Reichs niederlegen musste, auf der anderen Seite aber das Papsttum durch die Austragung dieses Konklaves in der Lagunenstadt gerettet.
Welche kuriosen Unwägbarkeiten hält die Geschichte noch bereit?
Schiefgehen kann, dass – wie im 18. Jahrhundert – auf einmal ein österreichischer Kaiser als ein Tourist in ein Konklave hineinspaziert; schiefgehen kann, dass in der Barockzeit die Gesandten der katholischen Mächte von Venedig bis Madrid ein- und ausgehen in der eigentlich abgeschotteten Konklavezone; schiefgehen kann, dass man Wähler unter Druck setzt, wie das bis 1621 leicht möglich war, denn dann wurde erst die schriftliche geheime Wahl zum Standard und vorher wusste man ganz genau, welcher Kardinal für wen stimmte beziehungsweise stimmen musste. Problematisch kann vor allen Dingen aber auch ungebührlicher, äußerlicher Druck auf die Wähler sein. Dieser kann in der Jetztzeit medial – vor allem durch Social Media – erzeugt werden, es kann sich aber auch um politischen Druck handeln. Noch bis ins 20. Jahrhundert hinein hatten katholische europäische Höfe und Großmächte ein in keiner Konklave-Ordnung auftauchendes, aber dafür umso eifriger genutztes Recht der Exklusive, also ein faktisches Vetorecht. Zuletzt wurde 1903 davon Gebrauch gemacht, als die Österreicher gegen Kardinal Rampolla ihr Veto einlegten. Der dann zum Papst gewählte Giuseppe Sarto, Pius X., hat dieses Recht der Exklusive abgeschafft.
Gibt es eine Herangehensweise, die sich angesichts solcher Herausforderungen besonders bewährt hat?
Bewährt hat sich in jedem Fall die strenge Abschottung der Wahlkardinäle in der Sixtinischen Kapelle und in dem angrenzenden Bereich, so dass es wirklich nicht möglich ist, noch irgendwie Informationen an sie heranzutragen. Sie sollen wirklich alleine mit ihrem Gewissen, mit sich selbst und mit diesem atemberaubenden Fresko des Jüngsten Gerichts von Michelangelo sein, vor dem sich alles abspielt.
Man hört und liest oft, man könne sich bei der Papstwahl auf den Heiligen Geist verlassen, der das Konklave lenke. Was halten Sie davon?
Joseph Ratzinger hat vor seiner Wahl zum Papst einmal gesagt, der Heilige Geist sitze nicht in der Sixtinischen Kapelle und suche sich jemanden aus. Man müsste die Rolle des Heiligen Geistes viel „elastischer“ auffassen: Selbst wenn die Wahl auf einen falschen Kandidaten fällt – und das ist in der Kirchengeschichte auch passiert –, lässt der Heilige Geist seine Kirche nicht im Stich, sondern führt sie in den großen Linien trotzdem in die richtige Richtung. Das finde ich aus dem Mund eines Mannes, der selber zum Nachfolger Petri wurde, doch irgendwie tröstlich.
Stefan von Kempis, geboren 1970 in Bonn, leitet die deutschsprachige Abteilung von „Vatican News“ und „Radio Vatikan“. Er hat Anfang April im Herder Verlag das Buch „Weißer Rauch und falsche Mönche – eine andere Geschichte der Papstwahl“ veröffentlicht. Er wohnt in Rom, ist mit einer Spanierin verheiratet und hat zwei Kinder.
Die Printausgabe der Tagespost vervollständigt aktuelle Nachrichten auf die-tagespost.de mit Hintergründen und Analysen.