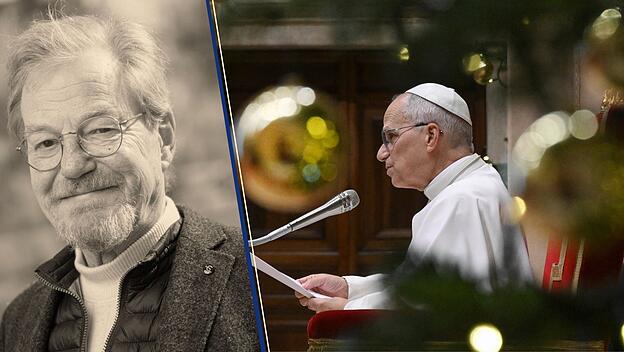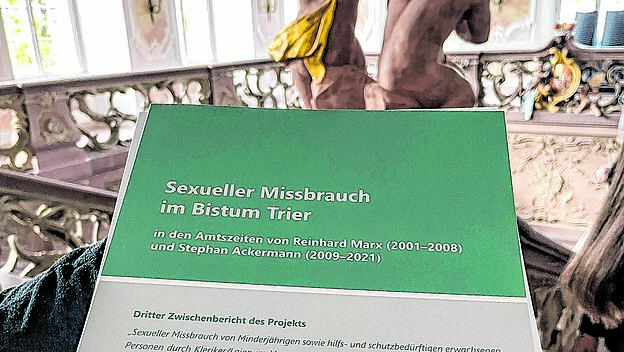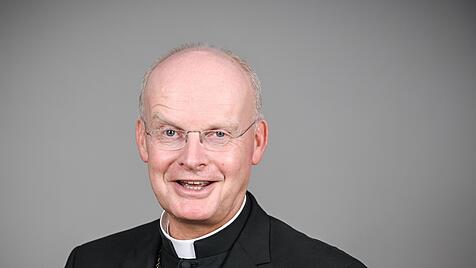Mit der Opferung Isaaks (1 Mos 22,1-19) hatte sich Reinhard Kardinal Marx für seine Bibelarbeit beim 37. Deutschen Evangelischen Kirchentag einen der anspruchsvollsten Texte des Alten Testaments vorgenommen. Die sich gerade auch mit dieser Schriftstelle verbindende Frage nach dem Wesen Gottes führte den DBK-Vorsitzenden dazu, auf einer grundsätzlichen Ebene über das Christentums in der Moderne nachzudenken. Hierzu erinnerte er an den tschechischen Theologen Tomas Halík, der – anknüpfend an Solschenizyn – fragte, „was jener Zeit folgen wird, in der es so viele Gläubige und Nichtgläubige für leicht hielten, über Gott zu reden“, und die Antwort gab: „Ich erwarte eine sehr, sehr lange Reise in die Tiefen. Und ich setze meine Hoffnungen darauf.“
Kirche muss sich im geschichtlichen Befreiungshandeln Gottes engagieren
Wie notwendig eine solche „lange Reise in die Tiefe“ ist, machte Abschlussgottesdienst aus dem Dortmunder Westfalenstadion deutlich, dessen Ästhetik einem Pop-Konzert glich und dessen politische Botschaften mehr durch Plakativität denn durch Differenziertheit geprägt waren. Das Grundproblem kam wie in einem Brennglas zum Ausdruck, als Predigerin Dr. Sandra Bils über die Ausrichtung der Kirche am Vertrauen auf Gott sprach: „Wir suchen und fragen dann gemeinsam mit anderen, welcher Lifestyle und welche Werte dem Willen Gottes entsprechen. Auch mit denen jenseits unserer Filterblase. Wir sehen wo Gott in der Welt wirkt – durch die Leute von Sea-Watch, SOS Méditerranée und Sea-Eye, durch Greta Thunberg und die Schülerinnen und Schüler, durch so viele andere – und dabei machen wir mit.“
Heikel ist hieran keineswegs der Appell an christliche Weltverantwortung. Vielmehr ist gerade an Gerhard Ludwig Kardinal Müllers – an Dietrich Bonhoeffers Idee der „Kirche für andere“ anknüpfende – Einsicht festzuhalten, dass Kirche nur Kirche Gottes sein kann, „wenn sie nicht einfach nur den Bestand und den Einfluß ihrer selbst als Organisation und Institution zum Ziel hat“, sondern sich „im geschichtlichen Befreiungshandeln Gottes engagieren“ lasse. Problematisch ist jedoch die Verschiebung des Fokus weg vom Befreiungshandeln Gottes – hin zu ‚Lifestyle‘, ‚Werten‘ und einer ‚Mitmach-Kultur‘, die ganz im Vorletzten aufzugehen scheint, sodass die Ausrichtung auf die letzten Dinge zu verblassen droht.
Aus christlicher Perspektive ist ein Umdenken notwendig
Der Kulturwissenschaftler Wolfgang Ullrich (Wahre Meisterwerte. Stilkritik einer neuen Bekenntniskultur, Berlin 2017) hat wiederholt die gegenwärtig inflationäre Berufung auf ‚Werte’ kritisiert – auf die ja wiederum die Vorstellungen eines entsprechenden ‚Lifestyles‘ und ‚Mitmachens‘ bezogen sind. Ullrich zeigt auf, wie sich das öffentliche Bekennen zu bestimmten Werten – zumal in den ‚sozialen‘ Medien – zu einem selbstinszenatorischen Selbstzweck steigert. Und ihn treibt die Sorge, „dass die Kultur insgesamt zu einem eitlen Parcours lauten Demonstrierens und Manifestierens von Werten gerät und schließlich zu einer aggressiven Bekenntniskultur wird“. Dies ist eine Entwicklung, welche nicht zuletzt ein erhebliches Potenzial hat, die Gesellschaft zu spalten. Gerade dies darf aus christlicher Perspektive nicht hingenommen werden und erfordert ein Umdenken – auch wenn das bedeuten könnte, anstelle von populären ‚Werten‘ wieder verstärkt altmodischen, aber weniger für Selbstinszenierung anfälligen, Begriffen wie ‚Sittlichkeit‘ und ‚Tugenden‘ Geltung zu verleihen.
DT
Die Printausgabe der Tagespost vervollständigt aktuelle Nachrichten auf die-tagespost.de mit Hintergründen und Analysen. Kostenlos erhalten Sie die aktuelle Ausgabe