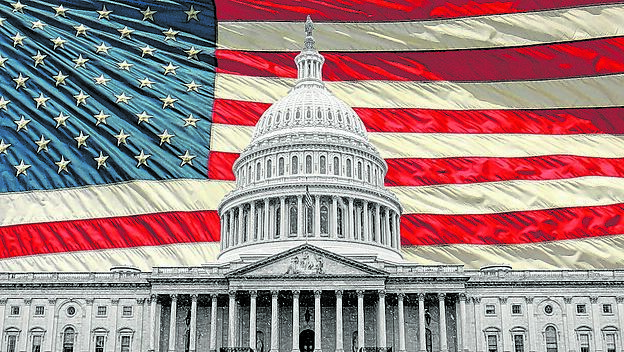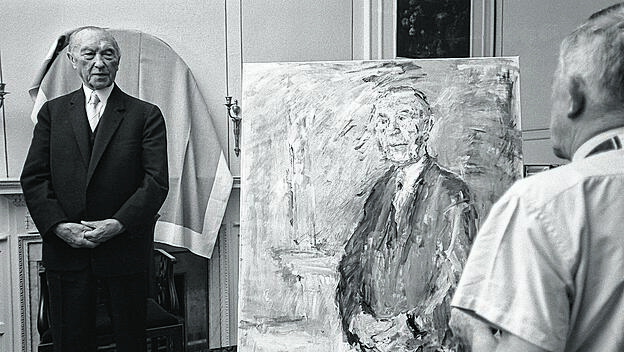Der dritte Tag des Sommerkurses der Gustav-Siewerth-Akademie startete mit einer Betrachtung der Geschichtsmorphologie. Der Historiker und "Tagespost"-Kolumnist David Engels sprach über Gottesgewissheit und historischen Vergleich. Engels betrachtete darin das Aufkommen und Untergehen der Hochkulturen der Weltgeschichte.
Der Begriff der Kulturmorphologie scheine überholt. Historiker betonten hingegen das Individuum als handelndes Subjekt der Geschichte. Das sei ein Bottom-up–Ansatz. Das Wiederaufleben von Religionen und Zivilisation widerspreche scheinbar der akademischen Geschichtsforschung. Eine Leugnung kollektiver Dynamiken in der Vergangenheit erfolge gerade um einer erhofften Zukunft der einen Welt willen. Vergleiche zwischen den verschiedenen Kulturen in den unterschiedlichen Zeiten hält Engels für sinnvoll. Er nennt dazu als Beispiel verschiedene Kolonialismen in verschiedenen Epochen.
Phasen der Hochkulturen
Engels untersucht einige unterschiedliche Ansätze der historischen Forschung. Gegenstand der Geschichte sei der Begriff der Zivilisation. Eine eigene historische Identität ermögliche einen Vergleich mit anderen Zivilisationen.
Jede Zivilisation sei als einzigartig zu betrachten, solange die Menschen von diesen Grundlagen getragen sind, werden sie dieser Zivilisation folgen. Die Stufen der Zivilisation verfolgen Engels zu Folge mit These, Antithese und finale Synthese dialektischen Strukturen. So können verschiedene Zivilisationen in den unterschiedlichen Phasen verglichen werden. Ausgehend vom Begriff Transzendenz, in dem der Mensch sein Sein von einer hören Existenz ableiten ohne mit ihr zu verschmelzen.
Reine Materialität würde demgegenüber keine Alternativen zulassen und zu einer Leere führen, was der beste Nachweis der Existenz einer Transzendenz sein sollte. Gott wurde in den unterschiedlichen Kulturen verschieden wahrgenommen und beschrieben. Transzendenz sei der Welt übergeordnet, die sei Welt geschaffen, damit werde diese ein Spiegel der Schönheit, Wahrheit und Gutheit. Die Welt müsse mithin von derselben Substanz sein, daher könne sie daran teilhaben, und so komme eine Vorstellung der Seele, die am Ende in die Transzendenz übergehe. Die Ablehnung der Transzendenz führe somit zu einem Verfall der Hochkultur. Das gelte für das Abendland und alle Hochkulturen in der Vergangenheit.
Zugang zum Höchsten
Alle Zivilisationen entwickeln ihren Zugang zum höchsten Einen. Engels beschrieb die Stufen des Verfalls einer Zivilisation eingeleitet durch die Ablehnung der Transzendenz, den stärker werdenden Materialismus, die die Zivilisation entleert. Der Historiker gab einen Überblick über die Stufen des Verfalls vergangener Hochkulturen, der einem Parforceritt glich. Darunter waren die Sumerer, Ägypter, Babylonier, Assyrer, das alte China, die islamische und meso-amerikanische Kultur sowie am Ende das antike Altertum und das Abendland.
In all diesen Kulturen ließen sich Engels zu Folge die Phasen von These, Antithese und Synthese nachweisen. All diesen Kulturen gemeinsam sei in der These eine je unterschiedliche Vorstellung der Transzendenz zu eigen. In der Antithese werde diese dekonstruiert und in der Synthese erstarre die Vorstellung von Transzendenz in einer Wiederherstellung zu fast kristallinen und starren Strukturen. Dies stelle die letzte Phase der Kultur dar und leite deren Ablösung ein.
Nach dieser "Tour de Raison" warf Engels einen Blick auf unsere eigene Hochkultur, die wir gemeinhin das Abendland nennen. Als Beginn des Abendlandes nahm der Althistoriker die Krönung Karls des Großen an. Diese leite die These ein. Es sei die zentrale Entscheidung, diese stelle eine nicht rein politisch dar. Die neue Gründung des Heiligen Römischen Reiches stelle auch eine Emanzipation des Westens von der Ostkirche dar. Das Reich sei mit der römischen Kirche untrennbar miteinander verbunden.
Der Kern des Abendlandes
Der religiöse Kern dieses Abendlandes sei ohne Zweifel das römische Christentum, jedoch sei dies nicht synonym zum Abendland. Christentum gebe es auch in anderen kulturellen Kontexten. Das erste und zweite christliche Jahrtausend unterschieden sich wesentlich. Engels verwies dabei auf den – theologischen - Konflikt zwischen Ost- und Westkirche.
Das unbändige Streben nach dem Absoluten – das Habsburgische Plus ultra – sei gerade der Kern des Abendlandes. Nach dem Beginn der frühen Neuzeit erfolge eine Verlagerung auf die Eroberung der materiellen Welt.



Einen faustischen Impuls stellte Engels hier in der abendländischen Geschichte fest. Die Geschichte des Mittelalters sei die thetische Phase mit seiner Dogmengeschichte und Kongruenz zwischen Theologie und Philosophie. Antithetisch sei dann die Neuzeit. Mit der Wende vom 15. zum 16. Jahrhundert zeige sich ein Bruch. Das Individuum werde zum Maß aller Dinge und verdränge Gott. Die Reformation zerstörte die Einheit der Kirche. Nationalstaaten verdrängten die Einheit des Reiches. Schließlich werde die Erwartung der Parusie zu unbändigem Fortschrittsglauben.
Die Entwicklung des Abendlandes
Dennoch stecke viel von den ersten 500 Jahren noch in den zweiten 500 Jahren des Abendlandes. Es gebe zahlreiche geistesgeschichtliche Parallelen, führte Engels aus. Die Diktatur des Relativismus sei nun der Höhe- und der Endpunkt der Antithese. Die Antithese steuere auf ihre Auflösung und damit auf die finale Synthese zu. Eine Art augusteische Synthese sei wahrscheinlich, nimmt Engels an. Die Rückkehr zur Transzendenz werde zur Engführung der abendländischen Kultur führen.
Wie nun, so die abschließende Frage, sei unsere Haltung gegenüber der Zukunft? Jede Zivilisation so Engels, erschöpfe sich und verschwinde am Ende. Der Untergang des Abendlandes sei realistisch, das leugne aber nicht den Fortbestand von Menschen in Europa.
Es scheine logisch und unausweichlich, dass jede Hochkultur untergehe, so der Historiker. Es gehe nicht darum, das Abendland zu retten, sondern ihm zu erlauben, seine Rolle in Würde bis zum Ende zu spielen. Nicht die eigene Sterblichkeit leugnen, vielmehr das unermesslich wertvolle Erbe zu bewahren und für künftige Zivilisationen zu überliefern, das sei die Aufgabe. Dies sei, schloss Engels, die einzige Form der Unsterblichkeit des Abendlandes. Es gelte, die Inhalte für künftige Zivilisationen zu bewahren. Abschließend stehe die Frage nach unserem eigenen Seelenheil. Die Tür zur Transzendenz solle sichtbar und offen sein, wir selber müssten sie aber auch durchschreiten, beendete der Althistoriker seinen Vortrag.
Eine steile Lernkurve
Die Moderatorin des Sommerkurses, Mechthild Löhr, bedankte sich für den Vortrag und stellte fest, in der vergangenen Stunde die steilste Lernkurve ihres Lebens erlebt zu haben. Der Applaus des Publikums bestätigte sie in ihrem Lob des Vortrags. Löhr dankte den Referenten für eine eindrucksvolle Darstellung. Wie an jedem Tag stand auch Mittwochmittag wieder die Feier der Heiligen Messe auf dem Programm. Es zelebrierte der emeritierte Weihbischof Marian Eleganti aus Chur.
Lesen Sie in der kommenden Ausgabe der Tagespost eine umfassende Reportage über den diesjährigen Sommerkurs der Gustav-Siewerth-Akadamie.