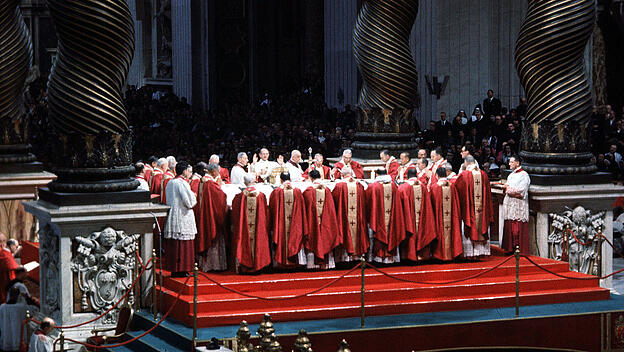Am letzten Sonntag des Kirchenjahres hält die Liturgie einen feierlichen Moment inne, um das Geheimnis der Menschwerdung Christi in seiner vollen Tiefe zu preisen, bevor mit dem Advent und der Geburt Jesu der Jahreskreis wieder von vorne beginnt. Die Kirche feiert Christkönig – ein Fest, das oft eher beiläufig mitgenommen wird. Dabei ist Christkönig ein Ausbruch des Jubels, ein Höhepunkt des Kirchenjahres, der eine eigentümliche Spannung in sich trägt. In Musik, Dichtung und Literatur wurde diese Spannung immer wieder aufgegriffen und soll hier an einigen Beispielen aufleuchten.
Einerseits hat das Fest „Christkönig“ etwas Monumentales und Triumphales; es verweist auf den König aller Könige und sein Reich, die ewige Herrlichkeit, der die Christen entgegengehen. Gleichzeitig erinnert Christkönig an die Endlichkeit: an den Tod Christi am Kreuz, an dem der Mensch nicht unschuldig war, aber auch an den eigenen Tod.
Eine Macht, die irdische Kategorien auf den Kopf stellt
Schließlich erinnert das Fest von Christkönig daran, dass das Königtum Christi im Leiden und in der Hingabe am Kreuz seine Erfüllung findet. Es stellt den Menschen vor die Erfahrung einer Macht, die alle irdischen Kategorien der Herrschaft und Macht auf den Kopf stellt. Es zeigt, dass der Tod und die Auferstehung Jesu der Schlüssel zu seinem Königreich sind und das Kreuz der Ort ist, an dem Gott dieses Reich der Liebe und des Lebens etabliert.
Diese Hoheit, die sich gewissermaßen am Kreuz vollendet beziehungsweise erst durch Kreuz und Auferstehung voll verwirklicht wird, wie Papst Benedikt XVI. lehrte, hat Theologen und Schriftsteller immer wieder beschäftigt, darunter C. S. Lewis („The Great Divorce“) und Romano Guardini („Der Herr").
Rainer Maria Rilke beschreibt in „Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge“ das Kreuz gewissermaßen als den stillen Punkt in einer sich drehenden Welt — als einen Ort, an dem Leben und Tod, Beständigkeit und Veränderung zusammenkommen und scheinbare Widersprüche wie Leiden und Erlösung, Tod und Auferstehung sich in einem einzigen Moment der göttlichen Wahrheit vereinen.
Das größte Skandalon der Geschichte
In der Musik lässt unter anderem der französische Organist und Komponist Olivier Messiaen den Triumph des auferstandenen Königs in seinen Werken aufleuchten – nicht als irdischen Glanz, sondern als farbige und vor allem mystische Liturgie des Himmels. Besonders eindrücklich bringt dies Händels „Messias“ zum Ausdruck: Das machtvolle „King of Kings“ beispielsweise erklingt nicht im Glanz eines Palastes, sondern im Licht des geopferten Lammes, das in einer Arie besungen wird: „Er ward verachtet und von den Menschen zurückgestoßen, ein Mensch der Schmerzen…“ Später singt der Chor: „Wie Schafe gingen wir alle in die Irre, ein jeglicher von uns wandte sich zu seinem eigenen Weg. Und der Herr legte ihm auf all unsere Missetaten.“
Dass Gottes Sohn sterben musste, um am Kreuz erhöht zu werden und dann alle Menschen an sich zu ziehen, ist das vielleicht größte Skandalon der Geschichte und zugleich das Tor zum Paradies, geöffnet durch die Hingabe Jesu an den Willen Gottes: „Nicht mein, sondern dein Wille geschehe.“ Noch unfassbarer: Nicht Leiden und Schmerz haben das letzte Wort, sondern die Auferstehung und das Leben. Im „Messias“ findet Händel hier zum Lobpreis und bekennt zugleich den Kern des christlichen Glaubens: „Ich weiß, dass mein Erlöser lebt und dass er am jüngsten Tage auf der Erde stehen wird (Hiob 1, 25). Nun aber ist Christus auferstanden von den Toten, der Erstgeborene jener, die schlafen (1.Korinther 15,20)“, singt der Sopran.
Musik im Freudentaumel
Und dann explodiert regelrecht die Freude, wenn der Chor Psalm 24 zitiert: „Erhebet, ihr Tore, eure Häupter, und erhebet euch, ewige Pforten, dass einziehe der König der Herrlichkeit!“ Die beeindruckende Polyphonie, begleitet von majestätischen Trompeten und tiefen Bässen, kulminiert in Worten aus der Offenbarung: „Halleluja, denn der Herr, der allmächtige Gott, herrschet. Das Königreich dieser Welt ist zum Königreich unseres Herrn und seines Christus geworden; und er wird regieren auf immer und ewig. König der Könige, Herr der Herren, Halleluja.“
Im Widerspruch zur Logik des Sichtbaren
Übrigens, eine amüsante, wenn auch vermutlich nicht ganz zutreffende Anekdote besagt, dass bei der Londoner Premiere des „Messias“ im Jahr 1743 der englische König Georg II. nach dem „Halleluja“ des Chores aufgesprungen sei, weil er dachte, das Stück sei zu Ende — und damit die Tradition der Engländer begründete, sich an dieser Stelle des „Messias“ immer zu erheben.
Doch zurück zu Christkönig. In Händels „Messias" wird die Spannung des Christkönigsfestes beschrieben: Das leidende Lamm Gottes und der triumphierende Messias finden zu dieser bereits erwähnten Einheit, die menschlich kaum zu begreifen ist, weil sie der Logik des Sichtbaren widerspricht.
Benedikt XVI.: Gottes Königtum ist messianisch gemeint
Die Kirche glaubt an die Realität der unsichtbaren Welt. Gott hat seinen Kindern Heilige und Engel an die Seite gestellt, die sie begleiten. Er hat den Himmel geöffnet, damit sie hineingreifen und ein Stück Paradies auf die Erde holen können, damit die Welt sich nicht allzu sehr in sich selbst verliert, sondern das Reich Gottes auf Erden entfaltet. Gottes Kinder sind nicht von dieser Welt, aber in dieser Welt, lehrt das Johannesevangelium. Daran erinnerte auch Papst Benedikt XVI. als er sagte, dass Gottes Königtum nicht politisch, sondern messianisch gemeint ist. Es ist ein Königreich der Liebe, des Friedens und der Gerechtigkeit, das sich jenseits menschlicher Kategorien von Macht und Herrschaft manifestiert. Gottes Herrschaft ist eine sanfte Herrschaft.
Wagners „Parsifal“ gibt davon ein kunstvolles Echo: Dort herrscht der wahre König nicht durch weltliche Macht, sondern durch Mitleid. Nicht Macht, Wohlstand oder (Selbst-)Inszenierung gelten im Reich Gottes, sondern Demut und Selbsthingabe, Liebe und Barmherzigkeit. Im Christkönigsfest begegnet uns ein Herrscher, der sich dem Pomp verweigert und gerade dadurch eine neue Ordnung eröffnet – und doch bleibt er König, ein König, der die Herzen der Menschen sucht und in seiner Liebe zur Welt der wahre Herrscher bleibt. Sein Königtum bedroht nicht die Freiheit, es begründet sie.
Die Königswürde Christi neu ins Bewusstsein rufen
Auch die Lesungen des Tages sprechen nicht von Pracht, sondern von einem König, der richtet und aufrichtet, der dienend regiert, der sich zur Schmach macht, um zu siegen. Es ist die auf den Kopf gestellte Grammatik der Macht: Beziehung statt Besitz, Autorität durch Liebe, Königsein als Dienst – die nachzumachen der Christ aufgefordert ist. In seinem Gedicht „As Kingfishers Catch Fire“ bringt Gerard Manley Hopkins dies zum Ausdruck: Wenn der Mensch die göttliche Liebe aufnimmt, reflektiert er diese und bringt somit die göttliche Präsenz in allen lebenden Dingen zum Leuchten, ohne dass sie sich aufdrängt.
Grund genug, das Christkönigsfest, das mit der Liturgiereform des Zweiten Vatikanischen Konzils vom letzten Sonntag im Oktober auf den letzten Sonntag im Jahreskreis verlegt wurde, bewusst zu begehen und sich in das Geheimnis des Reiches Gottes mit hineinnehmen zu lassen, das so im Widerspruch zur Welt steht, aber so wohltuend anders ist. Papst Pius XI. hat dies begriffen, als er vor 100 Jahren das Hochfest der Königsherrschaft Jesu einführte.
Zu dieser Zeit blickte die Welt auf die Verwüstungen des Ersten Weltkriegs. Jahrhundertealte Monarchien waren verschwunden, Demokratien entstanden, Kirche und Staat wurden getrennt, der Laizismus gewann an Gewicht. Pius XI. wollte die Königswürde Christi neu ins Bewusstsein rufen – als Orientierung für das Leben und Hoffnung im Blick auf die Ewigkeit. Das Christkönigsfest lädt ein, sich nicht den Launen der Macht zu beugen, sondern der Souveränität Gottes und der Verbindlichkeit einer Wahrheit. Der heilige Augustinus wusste, dass das menschliche Herz erst dann Ruhe findet, wenn es sich dem König schenkt, der allein zur Wahrheit führt. Und so stellt Christkönig den Menschen letztlich vor die Frage: Wem gehört meine Loyalität wirklich?
Die Printausgabe der Tagespost vervollständigt aktuelle Nachrichten auf die-tagespost.de mit Hintergründen und Analysen.