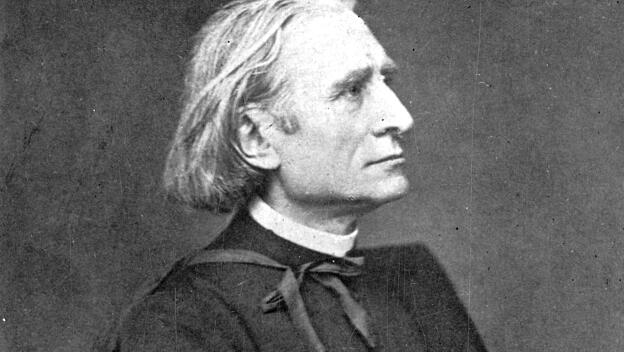Muss man in Zeiten, in denen das Einhalten der Maskenpflicht zum Unterscheidungsmerkmal schlechthin geworden ist, eine Inszenierung, die nur mit einem unverhüllt sprechenden Mund anhebt und um ihn herum alles andere ins schwärzeste Schwarz versinken lässt, als ein Zeichen des Widerstands deuten? Oder hat man an Berlins Komischer Oper nur aus der Not eine Tugend machen wollen?
Denn auf der riesigen Bühne des Hauses wird nicht all das gezeigt, was dort „ante Corona“ Abend für Abend im Genre einer Oper oder Operette mit Sängerensemble, Ballett und Chor und einem vielköpfigen Orchester einem fast immer ausverkauften Saal geboten wurde? In Zeiten wie diesen zeigt man stattdessen ein dreifaches Solo für die Sänger-Schauspielerin Dagmar Manzel, die in „Nicht ich“ und „Rockaby“ von Samuel Beckett und in Arnold Schönbergs Melodram „Pierrot Lunaire“ auftritt.
Zwischen tiefem Schweigen und unkontrolliertem Redeschwall
Die vom Intendanten Barrie Kosky inszenierte Aufführung beginnt mit „Nicht ich“. Das ist ein Monolog, den der irische Schriftsteller und Theaterautor für einen sprechenden weiblichen Mund geschrieben hat, alles andere von ihr soll unsichtbar bleiben. Was dieser Mund uns mitteilt, ist die Generalbeichte einer alten Frau. Die allein aus sexueller Begierde ohne Liebe Gezeugte wuchs in einem katholischen Waisenhaus zur Gottesliebe erzogen auf, blieb lebenslang eine in tiefstem Schweigen Verharrende, die nur ein oder zweimal im Jahr von dem plötzlichen Drang zu erzählen erfasst wird. Um, wie Beckett sie sagen lässt, „dann rausrennen zum ersten besten den sie sah ... zum nächsten Abort ... beginnen es auszuschütten ... unablässiger Schwall ... verrücktes Zeug ... Hälfte der Vokale verkehrt ... niemand konnte folgen ... bis sie sah wie man sie angaffte ... dann zu Tode schämen ... sich wieder verkriechen“.
Seit der Uraufführung von „Not I“ (wie das Stück im Original heißt) im New Yorker Lincoln Center am 27. November 1972, bei der Beckett selbst die Regie übernommen hatte, wird der Monolog wie vom Autor inszeniert in einem rasenden Sprechtempo vorgetragen. An diese Regel hält sich, artifiziell und sprech-technisch brillant, auch Dagmar Manzel und erweist sich darin einmal mehr als eine der Größten in ihrem Fach.
Bis ins Detail festgelegte Regieanweisungen
Der tiefere Sinn des Textes enthüllt sich dem, der erfasst, dass er in der Spannung zwischen den Schlüsselsätzen „da sie ja erzogen worden war ... mit den anderen Waisen ... im Glauben .., an einen gnädigen ... kurzes Lachen. ... Gott ... Volles Lachen.“ und „Gott ist Liebe ... sanfte Gnaden ... alle Morgen neu“ besteht. Woraus wir den Schluss ziehen, dass Samuel Beckett in „Nicht ich“ auf einer Theaterbühne eine katholische Ohrenbeichte zu simulieren wünschte, bei der ein Priester im Beichtstuhl hinter dem Gitter auch kaum mehr als nur den Mund des Pönitenten wahrnimmt.
Im Kontrast dazu darf sich die Schauspielerin in „Rockaby“ als Ganzes zeigen. Auch hier hat Beckett in seinen Regieanweisungen bis ins Detail festgelegt, auf welche Weise sie sich in einem hochgeschlossenen und mit Pailletten besetzten schwarzen Abendkleid im Schaukelstuhl wann zu wippen hat und wann nicht, um dabei ihrem von einem Tonband kommenden Monolog zu lauschen, in dem sie so lange die Momente ihres eigenen Todes beschreibt, bis dieser dann tatsächlich eintritt. Zum Kontrast gehört auch, dass diesmal betont langsam gesprochen werden darf.
„Eines muss ich sofort und mit aller Entschiedenheit sagen:
Pierrot Lunaire ist nicht zu singen!“
Seinen Biographen zufolge steht das von Beckett verlangte Schwarz für dessen dunkle Sicht auf das menschliche Leben an sich, und der Schaukelstuhl ist dann wohl ein Symbol für das Leben von der Wiege bis zur Bahre. In einer tradierten Anekdote spaziert der Ire mit einem französischen Bekannten an einem sonnigen Frühlingstag durch den Pariser Jardin des Tuileries. „Ist das Leben nicht schön?“, wird Beckett von ihm gefragt. „Soweit würde ich nicht gehen“, ist alles, was er zur Antwort erhält.
Entschieden heller geht es im dritten Teil des Abends zu. In Arnold Schönbergs „Pierrot Lunaire“ wird die Bühne bis zur Brandmauer geöffnet. Bis auf ein Bett ist die Bühne leer. Mehr benötigt Dagmar Manzel nicht, um uns, wie von Schönberg gewünscht, die vom Belgier Albert Giraud 1884 gedichteten und von Otto Erich Hartleben 1892 ins Deutsche übertragenen Verse in der Manier des Sprechgesangs vorzutragen. So nämlich hat es Schönberg bei der Uraufführung seines ersten atonalen Werkes intendiert: „Eines muss ich sofort und mit aller Entschiedenheit sagen: Pierrot Lunaire ist nicht zu singen! Gesangsmelodien müssen in einer ganz anderen Weise ausgewogen und gestaltet werden als Sprechmelodien. Sie würden das Werk vollkommen entstellen, wenn Sie es singen ließen, und jeder hätte recht, der sagte: so schreibt man nicht für den Gesang“, hält er in einem Brief an einen Schüler fest.
Gute-Nacht-Geschichten aus dem Bett
Vom mondestrunkenen Pierrot erzählt uns Dagmar Manzel nicht im allseits bekannten weißen, locker fallenden Kostüm der Typenfigur der Comédie italienne, auch trägt sie keine weiße Maske vor dem Gesicht. Stattdessen kommt sie als Kind im Matrosenanzug (mithin so eingekleidet, wie es 1912 nicht nur in Adels- und Großbürgerkreisen bei Heranwachsenden üblich war), das uns, um das Schlafen-Müssen hin-auszuzögern, vom Bett aus eine Gute-Nacht-Geschichte erzählen möchte. So erzielt sie eine Distanz, die den Versen unbedingt gut tut.
Denn erst der vorgetäuschte Kindermund ist es, der einen Text scheinbar erträglich macht, der zwischen Kitsch („Wein, den man mit Augen trinkt/ gießt nachts der Mond in Wogen nieder“) und Religionskritischem („Mit segnender Gebärde/ Zeigt (Pierrot) den bangen Seelen/ Die triefend rote Hostie:/ Sein Herz – in blutgen Fingern –/ Zu grausem Abendmahle!“) mäandert. Doch wie Dagmar Manzel ihn vorträgt, wie sie generell, ob als sprechender Mund oder als Dame in Schwarz, diesen Abend ganz allein trägt, das ist dann kein „Corona-Theater“ mehr, sondern Kunst.
Die Printausgabe der Tagespost vervollständigt aktuelle Nachrichten auf die-tagespost.de mit Hintergründen und Analysen.