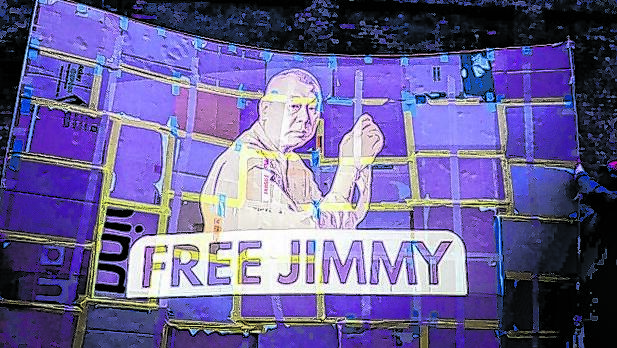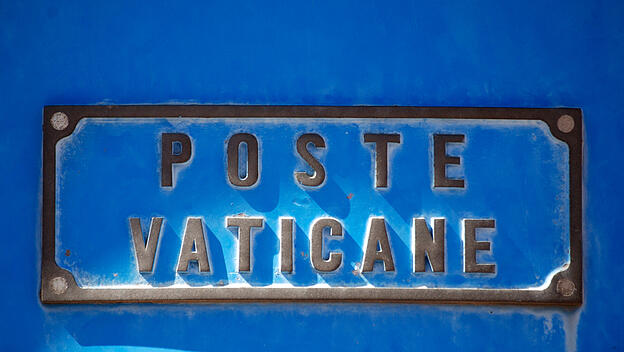Der erste Absatz macht gleich Eindruck: „Wir, das Zentralkomitee der deutschen Katholiken (ZdK), vertreten die Anliegen der katholischen Gläubigen in Deutschland und geben ihnen eine Stimme. Aus unserem Glauben leiten wir den Auftrag ab, Kirche, Gesellschaft und Politik aktiv mitzugestalten.“ Ausgehend von Evangelium und christlicher Tradition und auf der Grundlage der katholischen Soziallehre wolle man „sachliche Lösungen erarbeiten“. Etwa 20 Millionen Katholiken gibt es in Deutschland, die allermeisten davon dürften wahlberechtigt sein. Theoretisch sollten die „politischen Erwartungen“, die das ZdK wie ein meinungsbildender Think-Tank anlässlich der Bundestagswahl formuliert und gestern veröffentlicht hat, also das Zeug haben, die Wahl zu entscheiden.
Entstanden ist durch die Arbeit des Zentralkomitees ein 16-seitiges Dokument im Stil eines eigenen Wahlprogramms und Weisungen von A wie Abtreibung bis Z wie Zivilgesellschaft, das von den Gläubigen zur Formung ihrer Wahlentscheidung lediglich noch mit real existierenden Programmen abgeglichen werden muss. Da bekanntermaßen auch etliche der Partei-Wahlprogramme mit nicht gegenfinanzierten Vorschlägen glänzen, ist es dem ZdK nicht anzulasten, wenn es bereits in der Präambel heißt, die erhobenen Forderungen seien im bestehenden finanzpolitischen Rahmen nicht umsetzbar – vielmehr ist der explizite Hinweis aller Ehren wert.
Schulden für den Sozialstaat?
Doch was konkret ergibt sich für das ZdK nun aus der Soziallehre – außer der einleitenden Erklärung, dass man zwar „mit allen Menschen guten Willens“ die Diskursräume offenhalten wolle, aber nicht mit der als einzige Partei explizit erwähnten AfD? Die Autoren beginnen mit einem Bekenntnis zum guten Leben: „Wir setzen uns ein für das Recht eines jeden Menschen auf ein gutes und friedliches Leben in einer gesunden Umwelt, auf menschenwürdige Arbeitsbedingungen, angemessenen Wohnraum, auf gute Bildung und Gesundheitsversorgung und auf freie Religionsausübung.“ Damit verbindet das ZdK einen „leistungsfähigen und vorsorgenden Sozialstaat“, konkret eine „starke beitragsfinanzierte Sozialversicherung“ und eine „verlässliche und gut vernetzte soziale Infrastruktur“. Zugänglichkeit und Verlässlichkeit der sozialstaatlichen Leistungen entschieden auch über „die nachhaltige Zustimmung zur Demokratie“. Angesichts kaum bezahlbarer Mieten sei außerdem eine Intensivierung des „klimagerechten Neu-, Aus- und Umbau von Wohnraum“ geboten.
Interessanterweise verknüpft das ZdK ausgerechnet die Forderung nach einem starken Sozialstaat, also laufenden Ausgaben, nicht Investitionen, mit der Schuldenaufnahme: Man brauche „eine faire Steuerreform, eine Reform der Schuldenbremse und eine verantwortungsvolle Debatte über Sondervermögen“. Weniger konkret geht es weiter: „Vor allem brauchen wir eine ökologisch verantwortete Wirtschaftspolitik, die Arbeitsplätze schafft, faire Löhne garantiert und Anreize für qualitatives Wachstum setzt.“ Wer würde da widersprechen?
Mehr Migrationswege, aber nachhaltig
Christlich-großzügig geraten auch die Ausführungen zur Migration. Nicht anlassbezogen, sondern nachhaltig solle Politik diesbezüglich gestaltet werden – Vorschläge zur (menschenwürdigen) Reduktion von Migration finden sich in den ZdK-Forderungen aber nicht. Das Recht auf Asyl sei ein Menschenrecht, das nicht durch Kontingente oder „Abschottungspolitik“ eingeschränkt werden dürfe. Die bestehende Obergrenze für den Familiennachzug subsidiär Schutzberechtigter sei abzuschaffen, dafür müsse im Aufenthaltsgesetz ein Rechtsanspruch auf Geschwisternachzug verankert werden. Und: „Wir stehen solidarisch dafür ein, den Zugang zu individuellem Flüchtlingsschutz in der EU zu gewährleisten.“ Um das Leid und Sterben auf der Flucht zu beenden, brauche es mehr „legale Wege für Migrant*innen und humanitäre Korridore für Geflüchtete“ in die EU. Das Dublin-System müsse zwecks einer „gerechten Verteilung der Geflüchteten“ reformiert werden, Menschenrechte und Kindeswohl sollten die Leitlinien europäischer Asylpolitik sein.
Auch zu einer katholischen Familienpolitik haben sich die Autoren Gedanken gemacht. Man werbe für eine „Neuausrichtung, welche der familiären Vielfalt gerecht wird und Menschen in ihren Beziehungen ein Leben nach ihren Wünschen und Bedarfen ermöglicht“. Ein neuer („systemischer, nachhaltiger, multidimensionaler“) Ansatz solle Arbeit nicht länger auf Erwerbsarbeit verengen, müsse Sorgearbeit gerechter verteilen und Familie und Beruf „miteinander in Einklang“ bringen. Dazu schwebt dem ZdK ein „Optionszeitenmodell für atmende Lebensläufe“ vor – eine Reduzierung oder Unterbrechung der Erwerbsarbeit sei dann im Rahmen eines garantierten Zeitbudgets mit Lohnersatzleistungen möglich.
Kitaplätze, Lohnsteuerklassen und das Pariser Klimaabkommen
Kurzfristig brauche es mehr „finanzielle und infrastrukturelle Unterstützung“, konkret ein höheres und länger gezahltes Elterngeld. Darüber hinaus unterstütze man die Abschaffung der Lohnsteuerklassen 3 und 5 und die Implementierung des Faktorverfahrens, da dies „Anreize für die gleichberechtigte Beschäftigung auf dem Arbeitsmarkt schafft“ – gemeint ist hier wohl eher gleiche Beschäftigung. Auch das ZdK geht freilich davon aus, dass Mütter oft „weiterhin nicht im von ihnen gewünschten Umfang ihrer Erwerbstätigkeit nachgehen“. Weiter unten im Programm heißt es zudem, „gerade mit Blick auf die unter 3-jährigen Kinder“ fehlten derzeit 400.000 Kitaplätze, allerorten fehlten „Erzieher*innen“. Die Lösung: „Die Zukunft der Arbeit“ müsse „neu gedacht, verteilt, ermöglicht und gestaltet werden. (…) Die aktuellen Entlassungen etwa in der Autoindustrie können Betrieben, die Arbeits- und Fachkräfte suchen, auch Chancen bieten.“
In der Umweltpolitik fordert das ZdK, dem „gesellschaftlichen Rollback“ die Stirn zu bieten. Man stehe klar zu den „verbindlichen Zielen des Pariser Klimaabkommens“ – aus dem die USA per Dekret gestern ausstiegen –, es gelte, „die nötigen Maßnahmen zu ergreifen, um 1,5 Grad Celsius Erderhitzung nur so geringfügig und so kurzzeitig wie möglich zu überschreiten.“ Zur globalen Emissionsminderung und Anpassung an die Klimakrise seien zunächst neun, später zwölf Milliarden jährlich bereitzustellen, der Green Deal sei fortzuschreiben. Neben einer Betonung des Emissionshandels setzt das ZdK auch auf Instrumente wie ein Tempolimit von 120 km/h und einen „deutschlandweiten autofreien Sonntag“ zwischen dem 1. September, dem ökumenischen Schöpfungstag, und dem Erntedankfest.
Da die Verbrennung von Öl, Gas und Kohle die Klimakrise verursacht hätten, aber als „fossile, global ungleich verteilte Rohstoffe“ Kriege verursachen und befördern würden, brauche es eine „weitgehend autarke Energieversorgung aus erneuerbaren Energiequellen“. Die befähige Staaten denn auch „anstelle von Aufrüstung in Klimaschutz“ zu investieren. Die Nutzung der Kernenergie sei wegen unbeherrschbarer Risiken keine Alternative. Weil eine solche Energieversorgung auch „fairer und resilienter Lieferketten“ bedürfe, müsse die Bundesregierung die „die EU-Lieferkettenrichtlinie möglichst unbürokratisch, aber vor allem effektiv im Sinne der Betroffenen sowie EU-rechtskonform umsetzen“, also die große Reichweite des bestehenden deutschen Gesetzes mit den europäischen Fortschritten „gerade in den Bereichen Haftung und Beteiligung von Betroffenen“ verbinden.
Würde und Meinungsfreiheit, Leihmutterschaft und Suizidassistenz
Die Beziehungen zu anderen Ländern möchte das ZdK im Rahmen eines „neuen Multilateralismus“ bearbeitet sehen, die Verteidigungsbereitschaft soll angesichts der russischen Expansion nicht nur mit höheren Investitionen (das Wort Aufrüstung wird, da zuvor schon negativ geframed, vermieden) sondern auch durch „resiliente gesellschaftliche Strukturen“ gestärkt werden, „in denen zivile und gewaltfreie Verteidigung eingeübt werden kann.“ Dies gelte „insbesondere für neue Formen der hybriden Kriegsführung, die – oftmals mit Hilfe von KI – auf Destabilisierung von demokratischen Einrichtungen und Werte gerichtet sind.“ Denn, so der Text an anderer Stelle, „Diktaturen und populistische Kräfte“ nutzten das Internet um „Propaganda, Falschinformationen und Deepfakes zu verbreiten.“ Im digitalen Raum aber gebe es „Werte, die für alle gelten: Respekt vor anderen, die Achtung ihrer Würde und der Schutz vor Falschinformationen.“ Betreiber von Social-Media-Plattformen müssten „Hetze und Fälschungen im Netz effektiv unterbinden“ und stünden dabei in der Pflicht, Meinungsfreiheit und Freiheitsrechte gleichermaßen – scheinbar ein Widerspruch – zu schützen. Thematisch anschließend, gleichsam als positiver Gegenpart, schwebt dem ZdK auch vor, angesichts antisemitischer, antimuslimischer und rassistischer Straftaten die öffentliche Förderung von „zivilgesellschaftlichen Initiativen im Bildungsbereich“ weiter zu verstärken.
Fehlt noch die Bioethik: hier sprechen sich die Komitee-Katholiken für eine Beibehaltung der aktuellen Fassung des Abtreibungsparagraphen 218 des Strafgesetzbuches aus. Bei der Suizidassistenz halte man eine „ausgewogene Regelung“ für entscheidend, sodass nicht nur das „Selbstbestimmungsrecht der entschieden Suizidwilligen, sondern auch das jener Menschen geschützt ist, die durch Erwartungen Dritter zu suizidalen Handlungen gedrängt werden könnten.“ Ach dürften „Ärzt*innen und Pflegekräfte“ nicht zu Suizidassistenz gezwungen werden, die Suizidprävention unterstütze das ZdK ebenso wie „die Förderung alternativer Angebote psychosozialer und seelsorgerischer Begleitung von Menschen, für die der Suizid ein gangbarer Weg aus ihren Problemen zu sein scheint.“ Die selbstbestimmte Entscheidung ist für das ZdK auch beim Thema Leihmutterschaft und Eizellspende forderungsleitend: deren Legalisierung stehe man deshalb „skeptisch“ gegenüber, weil „besonders die Asymmetrien“ bedenklich seien, bei denen – immerhin – „zusätzlich Dritte erhebliche Belastungen tragen“ müssten.
Unter dem Stich ist dem ZdK ein beachtlich vollständiges Programm gelungen, das zu den allermeisten aktuellen politischen Fragen eindeutige Antworten präsentiert. Ein KI-gestützter Vergleich mit aktuellen Partei-Wahlprogrammen ergibt – um an dieser Stelle den geneigten katholischen Leser nicht mit eigener Rechercheleistung, die aber wohl zu ähnlichen Ergebnissen führen würde, zu überfrachten – die größte Übereinstimmung mit den Plänen der Grünen, insbesondere, so Chat-GPT, „in den Bereichen Klimaschutz, soziale Gerechtigkeit und Bildung.“
Katholische Wähler dürfen also umlernen: nicht die Union, die sie noch bei der Europawahl 2024 mit satten 43 Prozent (Zahlen der Forschungsgruppe Wahlen) wählten, sondern die mit 10 Prozent zuletzt leicht unterdurchschnittlichen Grünen vertreten demzufolge eine katholische Politik. Eine Destabilisierung der Demokratie durch eine entsprechende Wahlentscheidung, davon darf auch ohne KI-Hilfe ausgegangen werden, ist damit im Sinne des ZdK sicherlich nicht verbunden.
Die Printausgabe der Tagespost vervollständigt aktuelle Nachrichten auf die-tagespost.de mit Hintergründen und Analysen.