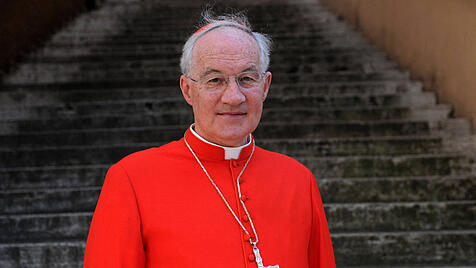2014 floh Ashur Sarnaya vor dem Islamischen Staat aus dem Irak nach Frankreich. Über zehn Jahre später ereilte ihn dort sein Schicksal. Während der Christ vor laufender Kamera ein Glaubenszeugnis gab, wurde er von einem „unbekannten Täter“ ermordet. Ein Extrembeispiel, aber kein Einzelfall: Auch in Europa sterben Menschen, weil sie Christen sind.
Der heute veröffentlichte Jahresbericht des „Observatory for Intolerance and Discrimination against Christians“ (OIDAC) alarmiert: Personenbezogene Übergriffe auf Christen – darunter auch Morde – haben 2024 in Europa zugenommen. Auch rechtlich wird in vielen Staaten der Druck auf Christen und christliche Positionen erhöht: Von Bannmeilen um Abtreibungskliniken über die Verbannung christlicher Symbole aus dem öffentlichen Raum bis hin zur Einschränkung von Gewissensfreiheit und Elternrechten hat OIDAC zahlreiche Fälle gesammelt, die christliche Gemeinschaften in Europa in Besorgnis versetzen.
Zahlen werden am Dienstag im Europäischen Parlament vorgestellt
Am Dienstag stellt OIDAC seinen Bericht auch in der Intergroup des Europäischen Parlaments für Religionsfreiheit, Glaubens- und Gewissensfreiheit vor. Ein wichtiger Meilenstein, denn: Auch politische und mediale Narrative tragen zu einem Klima bei, das antichristliche Akte erst hervorruft.
Das betonte auch ein im Juni veröffentlichter Leitfaden der OSZE zur Bekämpfung antichristlicher Akte. Der Leitfaden räumt den Staaten eine zentrale Verantwortung ein, wenn es um den Schutz christlicher Gemeinschaften geht und betont auch, dass in manchen Fällen „politische Diskurse und Narrative dazu beigetragen haben, antichristliche Vorurteile und Stereotypen aufrechtzuerhalten“. OIDAC verweist auf internationale Untersuchungen, nach denen Medienberichte oft stereotype oder verzerrte Darstellungen religiöser Themen transportieren: Beispiele aus mehreren Ländern zeigen, wie wiederholte negative Rahmungen christlicher Akteure die Schwelle zur realen Gewalt senken können.
Mit der Vorstellung des Berichts im Europäischen Parlament möchte Anja Tang, Direktorin von OIDAC Europe, „eine faktenbasierte Debatte anzustoßen – ohne politische Scheuklappen und mit dem gemeinsamen Ziel, konstruktive Lösungen zu finden“. Religionsfreiheit müsse stärker in den Blick rücken, gerade bei Gesetzen, die dieses Grundrecht mittelbar einschränken können, erklärt Tang gegenüber dieser Zeitung. Ihre konkrete Forderung: „Wir setzen uns für die Einrichtung eines EU-Koordinators zur Bekämpfung antichristlicher Hassverbrechen ein – analog zu den bestehenden Mandaten gegen Antisemitismus und antimuslimischen Hass.“
Datenerfassung in Deutschland muss verbessert werden
Die am stärksten von antichristlichen Akten betroffenen Länder sind laut OIDAC Frankreich, das Vereinigte Königreich, Deutschland und Spanien. Insgesamt 2.211 antichristliche Hassverbrechen rezensiert die in Wien angesiedelte Organisation. Dabei stützt sie sich auf ihre eigene Dokumentation sowie offizielle Polizeidaten und die Dokumente anderer internationaler Organisationen, die von der OSZE jährlich gesammelt werden. Die häufigsten Tathandlungen waren Vandalismus, Brandanschläge, Entweihungen, körperliche Angriffe, Diebstähle und Bedrohungen, ergänzt durch mehrere terroristisch motivierte Vorfälle, die teils von Sicherheitsdiensten verhindert worden seien, wie der Bericht angibt. Bei Brandstiftungen an Kirchen lag Deutschland 2024 an der Spitze: 33 der 94 dokumentierten Brandanschläge – insgesamt fast doppelt so viele wie im Vorjahr – erfolgten in Deutschland.
Die OSZE und OIDAC fordern die europäischen Staaten dazu auf, ihre Datenerfassung antichristlicher Verbrechen zu verbessen. In Deutschland werden antichristliche Hassverbrechen aktuell ausschließlich im Rahmen der politisch motivierten Kriminalität erfasst. Das bedeutet: Straftaten ohne eindeutig politisches Motiv – etwa Vandalismus oder Brandstiftung – tauchen in der Statistik schlicht nicht auf. Gegenüber dieser Zeitung erklärt Tang: „Dadurch entsteht ein verzerrtes Lagebild. Zahlreiche Übergriffe bleiben unsichtbar, obwohl die Realität vor Ort längst eine andere ist: Immer mehr Kirchen müssen außerhalb der Gottesdienstzeiten aus Sicherheitsgründen geschlossen bleiben.“
Für 2023 erfasste die polizeiliche Statistik zur politisch motivierten Kriminalität keine Brandstiftungen mit antichristlichem Hintergrund. OIDAC dokumentierte im selben Zeitraum 12 Brandstiftungen. Die OIDAC-Direktorin moniert: „Trotz dieser Entwicklung sieht die Bundesregierung keinen Handlungsbedarf. Das ist problematisch. Wir brauchen dringend eine eigenständige statistische Erfassung antichristlicher Hasskriminalität und eine gezielte Schulung von Polizeibeamtinnen und -beamten, damit entsprechende Vorfälle richtig erkannt und registriert werden.“
Dunkelziffern liegen weit höher
Der Bericht macht deutlich, dass die tatsächliche Zahl antichristlicher Akte in vielen Ländern noch weit höher liegen dürfte: Das OIDAC berichtet von einer anonymen Studie aus Polen, laut derer fast die Hälfte der befragten Priester im vergangenen Jahr Aggression erlebt hat, jedoch mehr als 80 Prozent diese Vorfälle nicht meldeten und daher in offiziellen Statistiken nicht auftauchen. Die Befragten berichten zudem von wachsender Unsicherheit im öffentlichen Raum und verweisen häufig auf negative mediale Darstellungen, die aus ihrer Sicht zum feindlichen Klima beitragen. Ähnliches habe eine Studie aus Spanien ergeben. Eine weitere Untersuchung aus Großbritannien bestätigt diesen Befund: Viele Christen berichten dort von Diskriminierung im beruflichen und gesellschaftlichen Umfeld, die aber oft ebenfalls nicht zur Anzeige gebracht würden.
Christliche Positionen bald illegal?
Besonders ausführlich schildert der Bericht die wachsenden rechtlichen Beschränkungen, die Christen in Europa betreffen. Ein zentraler Schwerpunkt liegt auf der Kriminalisierung christlicher Lehre und Seelsorge. Beispiel: In Großbritannien warnten über 1.000 christliche Kirchenführer, dass ein neues Gesetz zur Regulierung sogenannter „Konversionstherapien“ zu einem faktischen Verbot der christlichen Sexualethik führen könnte, weil die Bestimmungen so unbestimmt formuliert seien, dass sogar Predigten, Gebete oder pastorale Gespräche kriminalisiert werden könnten.
Der Bericht fasst zusammen, dass unter solchen Bedingungen selbst das Weitergeben grundlegender Glaubensinhalte rechtliche Risiken birgt. Christliche Positionen wie das Festhalten an der – auch biologisch gesicherten – Tatsache der menschlichen Zweigeschlechtlichkeit riskieren auch in Deutschland, als Hassrede gebrandmarkt und damit selbst diskriminiert zu werden.
Säkulare Erziehung schlägt religiöse Erziehung
Ein weiteres Kapitel betrifft die Einschränkung der Elternrechte und der religiösen Erziehung. Der Bericht erklärt, dass internationale Menschenrechtsnormen den Eltern eindeutig das Recht zuschreiben, die religiöse und moralische Bildung ihrer Kinder zu bestimmen. Dennoch dokumentiert OIDAC mehrere Fälle gravierender Eingriffe. Besonders bemerkenswert ist ein Urteil des spanischen Verfassungsgerichts, das einem evangelischen Vater untersagt, seinen Sohn zur Kirche mitzunehmen oder mit ihm in der Bibel zu lesen, und der säkularen Mutter die alleinige Entscheidungsbefugnis über die religiöse Erziehung zuspricht. OIDAC bewertet dieses Urteil kritisch, weil es eine säkulare Erziehung als „neutral“ behandelt und religiöse Erziehung als potenziell schädlich einstuft, was einen deutlichen Eingriff in das elterliche Recht und die Glaubensfreiheit darstelle.
Der Bericht erwähnt zudem Fälle, die die wachsende Spannung zwischen religiöser Präsenz im öffentlichen Raum und zunehmend restriktiven Auslegungen staatlicher Neutralität sichtbar machen. Dazu zählen die drohende Schließung katholischer Hospize in Großbritannien im Zuge neuer Sterbehilfegesetze, das Verbot eines Kruzifixes in einer bayerischen Schule durch ein deutsches Gericht oder die richterlich angeordnete Entfernung einer Krippe im französischen Beaucaire.
Solche Beispiele markieren nach Einschätzung von OIDAC einen Trend, der die öffentliche Sichtbarkeit des Christentums problematisiert und religiöse Ausdrucksformen aus dem öffentlichen Raum verdrängt.