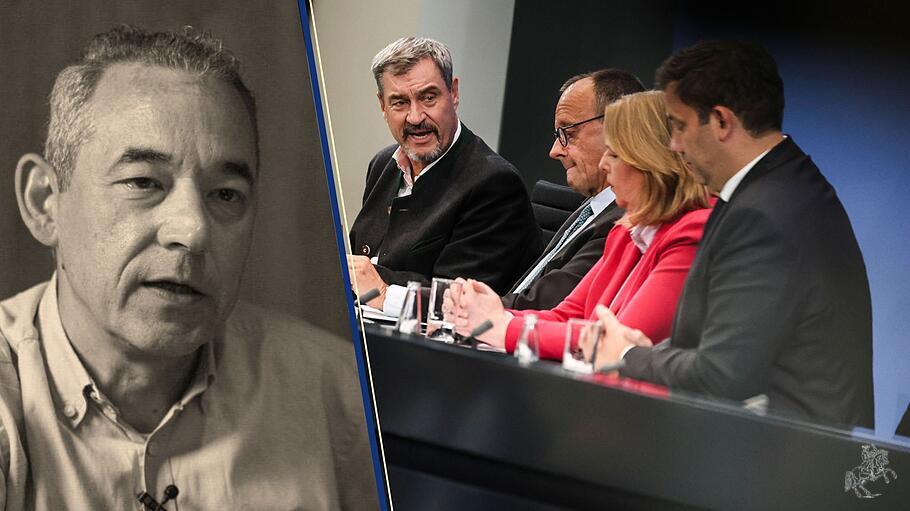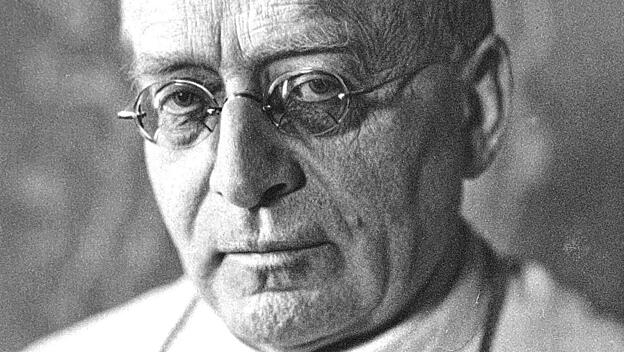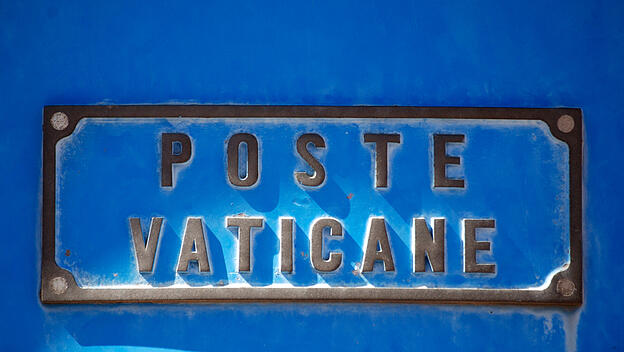Seit Jahren kehren immer mehr Deutsche der Bundesrepublik den Rücken. Waren es 2010 noch rund 141.000, so lag ihre Zahl laut dem Statistischen Bundesamt in Wiesbaden im vergangenen Jahr bei rund 270.000. Etwa die Hälfte von ihnen war zwischen 25 und 49 Jahre alt und damit im besten Alter für den Arbeitsmarkt. Unter ihnen befanden sich laut der Bundesärztekammer auch 1.279 Ärzte. Die von ihnen bevorzugten Zielländer: Schweiz, Österreich und die USA. Auch andere gut ausgebildete Deutsche tun es ihnen gleich: Selbstständige, Akademiker, Facharbeiter.
Bei den Zugewanderten sieht es nicht besser aus. 2024 verließen auch 918 Ärzte mit ausländischer Staatsbürgerschaft Deutschland. Laut einer Umfrage des „Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung“ denken 2,6 Millionen ausländische Beschäftigte (darunter viele Pflegekräfte) darüber nach, Deutschland wieder zu verlassen. Andere, weniger Qualifizierte, hingegen scheinen sich, obwohl sie es nicht müssten, immer öfter mit dem Bürgergeld zufriedenzugeben. So stieg die Zahl der erwerbsfähigen Bürgergeld-Empfänger laut der Wiesbadener Behörde von 1,43 Millionen im Jahr 2019 auf 1,81 Millionen im April 2025. Bleibt es bis Ende des Jahres dabei, wäre es der dritte Anstieg in Folge. Man muss nicht Mathematik studiert haben, um zu wissen, dass dies unmöglich gut ausgehen kann.
Fortschreitende Entsolidarisierung
Beide Trends deuten auf eine fortschreitende Entsolidarisierung hin. Eine, der mit altbekannten Rezepten und Politikern gebetsmühlenartig über die Lippen kommenden Forderungen wie der „Steigerung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit“, der „Erhöhung des Mindestlohns“ oder der „Sicherstellung des Lohnabstandsgebots“ allein nicht beizukommen sein wird. Was es braucht, ist ein Konzept, eine Vision oder Idee, die als Gegenentwurf zu einer „Gesellschaft der Singularitäten“ (Andreas Reckwitz) taugt.
Und genau hier hat niemand mehr zu bieten als die katholische Kirche. So lohnt sich etwa die Relektüre der Enzyklika „Laborem exercens“, die der heilige Papst Johannes Paul II. der Kirche 1981 schenkte und in der er den Wert der Arbeit, den diese für die Entfaltung des Menschen als Person besitzt, ausführlich darlegt. Der Mensch sei, so der Papst, berufen, durch produktive Arbeit an Gottes schöpferischer Tätigkeit teilzuhaben. Daher müsse gelten: „Zweck der Arbeit, jeder vom Menschen verrichteten Arbeit – gelte sie auch in der allgemeinen Wertschätzung als die niedrigste Dienstleistung, als völlig monotone, ja als geächtete Arbeit –, bleibt letztlich immer der Mensch selbst.“ Der arbeitende Mensch dürfe daher, so der Papst weiter, „nicht wie ein Instrument behandelt“ und „dem Gesamt der materiellen Produktionsmittel gleichgeschaltet“ werden. Vielmehr sei der Mensch als „Subjekt und Urheber“ der Arbeit das „wahre Ziel des ganzen Produktionsprozesses“.
Solidarität als Folge einer personalistischen Sicht auf Mensch und Arbeit
Wo Menschen so einander begreifen, ist Solidarität eine logische Folge, werden Arbeitgeber nicht als „Kühe“ betrachtet, die man melken darf und Arbeitnehmer nicht als „Humankapital“, das man ausbeuten darf. Staat und Gesellschaft sind gut beraten – schon aus ganz und gar eigennützigen Motiven heraus – sich neu mit der katholischen Soziallehre zu befassen und die Schätze zu heben, die sie angesammelt hat.
Die Printausgabe der Tagespost vervollständigt aktuelle Nachrichten auf die-tagespost.de mit Hintergründen und Analysen.