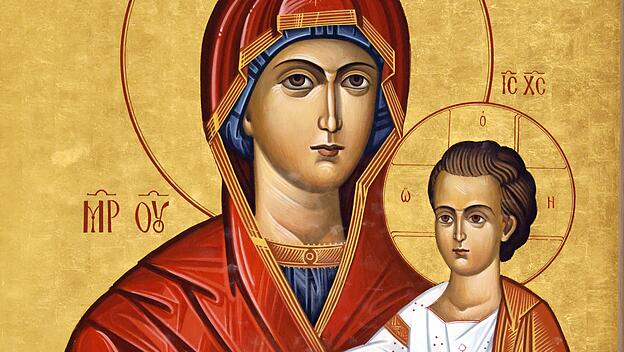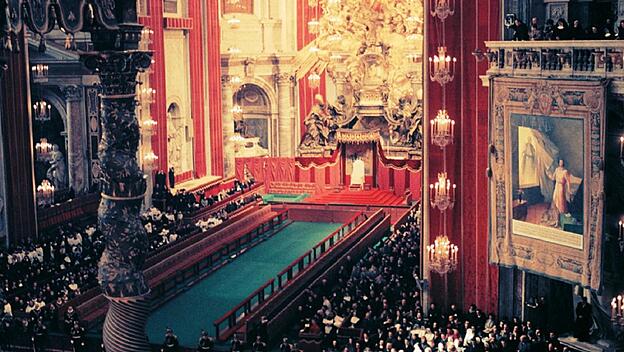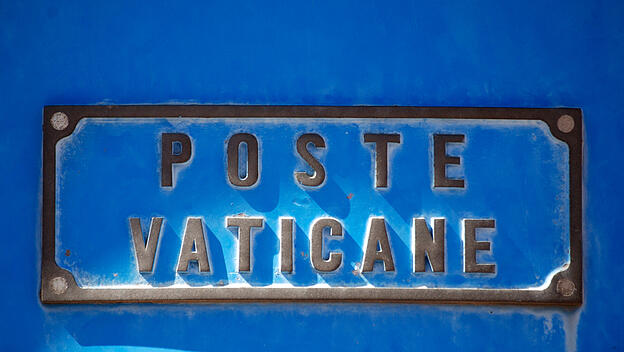Kein Stellvertreter Christi hat den Lebensschutz häufiger zum Thema gemacht als Papst Franziskus. Nicht einmal der heilige Papst Johannes Paul II., dessen Pontifikat beinah ein Vierteljahrhundert lang währte und der der Kirche die Enzyklika „Evangelium vitae“ schenkte, hatte beim Schutz des Lebens eine solche Frequenz an den Tag gelegt, wie der Jesuit Jorge Mario Bergoglio. Dabei griff der Argentinier, der sein Herz oft auf der Zunge trug, nicht selten zu drastischen Worten und Vergleichen. So auch bei der Generalaudienz vom 10. Oktober 2018.
Seit Wochen sprach der Jesuit auf dem Papstthron in seinen Mittwochskatechesen über die Zehn Gebote. Beim Fünften – „Du sollst nicht töten“ – angekommen, verglich er Abtreibungsärzte mit „Killern“. Wörtlich sagte der Papst damals: „Ich frage euch: Ist es richtig, ein menschliches Leben zu ,beseitigen‘, um ein Problem zu lösen? Ist es richtig, einen Auftragsmörder anzuheuern, um ein Problem zu lösen?“ Die Antwort lieferte der am Ostermontag Verstorbene gleich mit: „Das geht nicht, es ist nicht richtig, einen Menschen, so klein er auch ist, zu ,beseitigen‘, um ein Problem zu lösen. Es ist, als würde man einen Auftragsmörder anheuern, um ein Problem zu lösen.“
Ungeschliffener Streiter
Der Aufschrei ließ selbst in Medien, die dem bürgerlichen Lager zuneigen, nicht lange auf sich warten: „Bild.de“ sprach von einem „perfiden Vergleich“. Die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ wollte gar „aus allen Wolken“ fallen und stellte die Frage in den Raum, ob diesem Papst noch etwas heilig sei? Dabei hatte Franziskus auch die längst beantwortet. Sogar in derselben Ansprache. Weil für Gott „jeder Mensch“ das „Blut Christi wert“ sei (vgl. 1 Petr 1,18–19), müsse auch der Mensch jedes Leben wertschätzen. Das anderer ebenso wie das eigene. Denn: „Was Gott so sehr geliebt hat, darf man nicht verachten!“, so Franziskus.
Mehr noch: Der „Papst vom anderen Ende der Welt“, der gern die ungeschliffene Sprache einfacher Menschen benutzte, und sich nur selten die Mühe machte, mit sorgsam abgezirkelten Worten und wohlklingenden Formulierungen den Ohren der Gelehrten und Intellektuellen zu schmeicheln, legte gleich auch noch die Ursachen für die mangelhafte Bereitschaft, jedes menschliche Leben als „Geschenk Gottes“ zu betrachten, frei. Neben der dem Papst noch „verständlich“ erscheinenden „Angst“ heutiger Menschen, ihre individualistisch geprägten Komfortzonen verlassen zu müssen, sei es vor allem das Streben nach „Geld“, „Macht“ und „Erfolg“, das sie dazu brächte, „das Leben abzulehnen“.
Ein Kind ist immer ein Geschenk
Eine Trias, in der Franziskus „die Götzen dieser Welt“ erblickte. Wer das Leben anhand dieser „falschen Maßstäben“ bewerte, könne es gar nicht hinreichend wertschätzen. Denn das „einzige echte Maß für das Leben“ sei, so der Papst, „die Liebe, mit der Gott jedes menschliche Leben liebt“.
Auch in seinen Neujahrsansprachen an das beim Heiligen Stuhl akkreditierte diplomatische Korps kam Franziskus wiederholt auf den Schutz menschlichen Lebens zu sprechen. So etwa am 8. Januar 2024, als er neben der Abtreibung auch die Praxis der Leihmutterschaft scharf kritisierte. „Der Weg des Friedens“ erfordere, so der Papst, „die Achtung vor dem Leben, vor jedem menschlichen Leben, angefangen bei dem des ungeborenen Kindes im Mutterleib, das weder beseitigt noch zu einem Objekt der Kommerzialisierung gemacht werden darf.“ „In diesem Zusammenhang“ halte er auch „die Praxis der sogenannten Leihmutterschaft für verwerflich“, da sie sowohl „die Würde der Frau“ als auch die des Kindes „schwer“ verletze und „auf der Ausnutzung der materiellen Notlage der Mutter“ basiere.
„Ein Kind“ sei „immer ein Geschenk“ und „niemals ein Vertragsgegenstand“. „Ich plädiere daher dafür, dass sich die internationale Gemeinschaft für ein weltweites Verbot dieser Praxis einsetzt. Das menschliche Leben muss in jedem Moment seiner Existenz bewahrt und geschützt werden. Gleichzeitig stelle ich mit Bedauern fest, dass sich vor allem im Westen eine Kultur des Todes ausbreitet, die im Namen eines vorgetäuschten Mitleids Kinder, Alte und Kranke aussondert“, so Franziskus.
Wider die „ideologischen Kolonialisierungen“
Bei Gelegenheiten wie diesen konnte der Pontifex, der sich in seinen Ansprachen und Predigten in der Regel mit dem begnügte, was den Alltagserfahrungen der Masse der Gläubigen zugänglich war, auch schon einmal ganze Panoramen entfalten: „Der Weg des Friedens“, schrieb der Stellvertreter Christi den versammelten Diplomaten ins Stammbuch, „erfordere die Achtung der Menschenrechte, wie sie in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, deren 75-jähriges Bestehen wir kürzlich gefeiert haben, einfach und klar formuliert sind.“ Während es sich bei ihnen „um rational einleuchtende und allgemein anerkannte Grundsätze“ handle, hätten „die Versuche der letzten Jahrzehnte, neue Rechte einzuführen, die nicht ganz mit den ursprünglich definierten übereinstimmen und nicht immer akzeptabel“ seien, „zu ideologischen Kolonialisierungen“ geführt“.
„Ideologische Kolonialisierungen“ aber, unter „denen die Gender-Theorie eine zentrale Rolle“ spiele, seien nicht nur „sehr gefährlich“, „weil sie mit ihrem Anspruch, alle gleich zu machen, die Unterschiede“ auslöschten, sie dienten auch „nicht der Schaffung von Frieden“, sondern führten stattdessen „zu Wunden und Spaltungen zwischen den Staaten“.



Hatten seine Vorgänger, Johannes Paul II. und Benedikt XVI., die „Kultur des Lebens“ und die „Kultur des Todes“ systematisch ausbuchstabiert, so sprach Franziskus stattdessen, weniger vornehm, von einer „Wegwerfkultur“ und setzte damit neue Reize. Sollte dies sein Kalkül gewesen sein, wäre es aufgegangen. Kaum eine „fliegende Pressekonferenz“, bei der kein Journalist den Papst zu seiner längst sattsam bekannten Haltung zu Abtreibung oder Euthanasie befragte.
Bei Licht betrachtet war die keineswegs originell, sondern bloß katholisch. Im Grunde wiederholte auch Franziskus nur auf seine eigene, eher hemdsärmelige Art, was die Kirche von Anfang an lehrte: Dass, weil jeder Mensch „imago Dei“, Abbild Gottes, ist und Gott in Christus Mensch wurde, um die gefallene Menschheit zu erlösen, jedes menschliche Leben heilig ist. Darum versündigt sich, wer einen Mitmenschen aus einem anderen Grund als dem der Notwehr tötet, ihm dabei hilft, sich selbst zu töten oder ihm zumutbare Hilfe verweigert, letztlich gegen Gott.
Die Würde von der Empfängnis bis zum natürlichen Tod
Am 1. Januar dieses Jahres, Hochfest der Mutter Gottes und Weltfriedenstag zugleich, gab Papst Franziskus davon ein höchst beredtes Zeugnis. In seiner Predigt bei der Feier der heiligen Messe im Petersdom sagte er unter anderem: „Vertrauen wir dieses neue Jahr, das nun beginnt, Maria, der Gottesmutter, an, damit auch wir wie sie lernen, Gottes Größe in der Niedrigkeit des Lebens zu finden; damit wir lernen, für jedes Geschöpf, das von einer Frau geboren wurde, zu sorgen, indem wir zuallererst das kostbare Geschenk des Lebens hüten, wie Maria es tut: das Leben im Mutterleib, das Leben der Kinder, das der Leidenden, der Armen, der Alten, der Einsamen, der Sterbenden.“
Am Weltfriedenstag seien „wir alle aufgerufen, … dem Leben eines jeden ,von einer Frau Geborenen‘ seine Würde zurückzugeben“. Das sei „die grundlegende Basis für den Aufbau einer Zivilisation des Friedens“. Und weil das so sei, fordere er, „eine feste Verpflichtung zur Förderung der Achtung der Würde des menschlichen Lebens von der Empfängnis bis zum natürlichen Tod, damit jeder Mensch sein Leben lieben und hoffnungsvoll in die Zukunft blicken kann“.
Pilger der Hoffnung
Konsequenterweise ließ Papst Franziskus den „Katechismus der Katholischen Kirche“ ändern. Lautete dessen Ziffer 2267, in welchem die „Todesstrafe“ nicht gänzlich verworfen wurde, bis dahin: „Soweit unblutige Mittel hinreichen, um das Leben der Menschen gegen Angreifer zu verteidigen und die öffentliche Ordnung und die Sicherheit der Menschen zu schützen, hat sich die Autorität an diese Mittel zu halten, denn sie entsprechen besser den konkreten Bedingungen des Gemeinwohls und sind der Menschenwürde angemessener“ (KKK, 2267 alt) so gilt seit 2018: „Lange Zeit wurde der Rückgriff auf die Todesstrafe durch die rechtmäßige Autorität – nach einem ordentlichen Gerichtsverfahren – als eine angemessene Antwort auf die Schwere einiger Verbrechen und als ein annehmbares, wenn auch extremes Mittel zur Wahrung des Gemeinwohls angesehen. Heute gibt es ein wachsendes Bewusstsein dafür, dass die Würde der Person auch dann nicht verloren geht, wenn jemand schwerste Verbrechen begangen hat. Hinzu kommt, dass sich ein neues Verständnis vom Sinn der Strafsanktionen durch den Staat verbreitet hat. Schließlich wurden wirksamere Haftsysteme entwickelt, welche die pflichtgemäße Verteidigung der Bürger garantieren, zugleich aber dem Täter nicht endgültig die Möglichkeit der Besserung nehmen. Deshalb lehrt die Kirche im Licht des Evangeliums, dass „die Todesstrafe unzulässig ist, weil sie gegen die Unantastbarkeit und Würde der Person verstößt“ (vgl. LK 23, 40–43), und setzt sich mit Entschiedenheit für deren Abschaffung in der ganzen Welt ein“ (KKK 2267 neu).
Last but not least: Wie kein Papst vor ihm gewährte Franziskus Lebensrechtsorganisationen häufig Audienzen und sandte Grußworte zu den von ihnen überall auf der Welt veranstalteten „Märschen für das Leben“. Dabei ließ er sich auch nicht von Versuchen, sie als „Neurechte“ zu etikettieren, beeindrucken. Denn wie viele Lebensrechtler wusste auch der Papst, der die Kirche aufrief, an die Ränder zu gehen, dass das Herz der Bewegung keine Jungfrauen sind, sondern häufig Frauen und Männer, die in ihrem früheren Leben selbst von Abtreibungen betroffen waren und die die befreiende Erfahrung machen durften, dass Gottes Barmherzigkeit noch größer ist als seine Gerechtigkeit. Wäre es anders, hätte kaum ein Mensch Grund zur Hoffnung, wäre der „Pilger der Hoffnung“, als der Franziskus sich selbst sah, eine Farce, statt ein Vorbild, an dem Menschen auf ihrem Weg zu Gott Maß nehmen und an dem sie sich orientieren können.
Die Printausgabe der Tagespost vervollständigt aktuelle Nachrichten auf die-tagespost.de mit Hintergründen und Analysen.