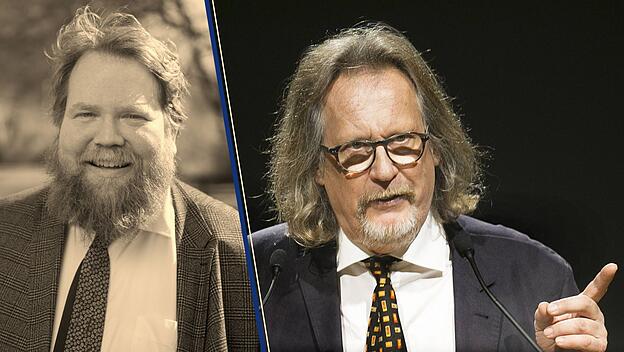Es war eine umstrittene Entscheidung, aber sie hat vorerst Bestand: Der AfD-Politiker Joachim Paul darf nicht zur Oberbürgermeisterwahl in Ludwigshafen antreten. Die entsprechende Entscheidung des Wahlausschusses, der Paul auf der Grundlage einer doch eher harmlosen, elfseitigen Beanstandungsliste des Verfassungsschutzes nicht zuließ, bestätigte das Verwaltungsgericht Neustadt an der Weinstraße am gestrigen Montag. Die Entscheidung des Wahlausschusses sei jedenfalls nicht offensichtlich rechtswidrig. Die vom Wahlausschuss berücksichtigten Zweifel an der geforderten Treue Pauls zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung (fdGO) inhaltlich abschließend noch vor der Wahl zu prüfen, sei nicht möglich, weshalb dies „zum Schutz der Beständigkeit von Wahlen“ dem (nachträglichen) Wahlprüfungsverfahren vorbehalten bleiben müsse.
Gerichtsbeschlüsse zu kommentieren, ist stets eine schwierige Übung. Wie sollen juristische Laien die Qualität gerichtlicher Entscheidungsfindung überhaupt beurteilen? Und doch ist die Meinungsbildung über für die öffentliche Sache so zentrale Fragen wie die, wer an Wahlen teilnehmen darf, natürlich geradezu Bürgerpflicht. Zumindest erstaunlich an der Entscheidung ist jedenfalls die Bezugnahme des Gerichts auf die AfD-Mitgliedschaft Pauls. Aus der gerichtlich bestätigten Einstufung der AfD als rechtsextremistischer Verdachtsfall ergäben sich Anhaltspunkte für Zweifel an Pauls Eintreten für die fdGO. Klingt zwar logisch, doch könnten mit dieser Begründung natürlich sämtliche AfD-Kandidaten aus Bürgermeisterwahlen ausgeschlossen werden, was einem faktischen Parteiverbot – wenigstens für diese Ebene – nicht ganz unähnlich sähe. Für ein solches jedoch ist bekanntlich nur das Bundesverfassungsgericht zuständig, und die Hürden sind aus gutem Grund hoch. Als Nächstes wird sich wohl das Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz mit dem konkreten Fall beschäftigen müssen.
Woher kommen all die „Nazis“?
Unabhängig von juristischen Erwägungen darf es aber nachdenklich stimmen, dass Wahlen vor Gericht und in Wahlausschüssen mitentschieden werden und nicht nur durch das demokratische Wählervotum. Zwar räumt das Grundgesetz im Rahmen der „wehrhaften Demokratie“ von Anfang an die Möglichkeit ein, demokratiefeindliche Kräfte von der Wahl auszuschließen. Mit Blick auf Hitler ist es wohl auch schwer zu leugnen, dass Wähler objektiv „falsch“ wählen können. Seit dem Verbot der Kommunistischen Partei und der Nazi-Nachfolger von der Sozialistischen Reichspartei in den 1950er-Jahren war es allerdings bis zu den NPD-Verbotsverfahren jahrzehntelang vergleichsweise still um diesen Instrumentenkasten geworden. Wie kommt es, dass Gedankenspiele zur Eingrenzung des politischen Spektrums und, wie der Fall Paul zeigt, auch handfeste Maßnahmen wieder derart Konjunktur haben?
Die Antwort hängt natürlich davon ab, wen man fragt: Während die eine Seite des politischen Spektrums auf die Radikalisierung der AfD verweist – polemisch formuliert: fassungs- und ratlos wahrnimmt, wie plötzlich überall demokratiefeindliche „Nazis“ aus Löchern kriechen, in denen sie scheinbar seit dem Krieg verweilten – würden Vertreter der Gegenmeinung darauf hinweisen, dass sich eben auch in Deutschland der international beobachtbare politische Rechtsschwenk zeige, der nicht zuletzt auf den spürbar negativen Konsequenzen einer lange Zeit ideologisch von links dominierten Politik beruhe. Neigt man letzterer Wahrnehmung zu, dann fällt jedenfalls auf, dass das Bedauern über Spaltung und Niedergang demokratischer Kultur zwar auch in anderen Ländern geteilt wird, Beschränkungs- und Verbotsfantasien jedoch in Deutschland besonders ernsthaft durchexerziert werden.
Die Entscheidung gehört grundsätzlich an die Wahlurne
Dass der demokratischen Verfasstheit Deutschlands mit Wahlausschlüssen wirklich gedient ist, darf auch vor diesem Hintergrund bezweifelt werden. Ja, Wähler können falsch entscheiden – aber von politischen Eliten angeregte juristische Vetos haben das Potential, die Legitimität des politischen Systems zu untergraben. Ganz grundsätzlich ist es besser, Wählern die freie Entscheidung über Wähl- oder Unwählbarkeit der Kandidaten für politische Ämter selbst zuzutrauen. Alles andere muss die (ja selbst undemokratische) Ausnahme bleiben. Nicht von ungefähr gilt das Parteienverbot als „ultima ratio“ – und Entscheidungen wie die in Rheinland-Pfalz weichen diesen guten Grundsatz de facto auf.
Dass man auch bei genauem Lesen der in der Gemeindeordnung dargelegten Anforderungen an Bürgermeister zu anderen Ergebnissen als die Mehrheit im befassten Wahlausschuss kommen kann, belegt nicht zuletzt die eine Gegenstimme zum Ausschluss Pauls. Die kam nämlich nicht von der AfD (wie die „Welt“ berichtet, verpasste die Partei die Frist, einen Vertreter in den Ausschuss zu entsenden), sondern von der FDP. Wem die Freiheit der Bürger etwas wert ist, der kann nur Bauchschmerzen bekommen, wenn die Entscheidung über Volksvertreter nicht nur an der Wahlurne, sondern auch im kleinen Kreis einer etablierten politischen Elite getroffen wird.
Die Printausgabe der Tagespost vervollständigt aktuelle Nachrichten auf die-tagespost.de mit Hintergründen und Analysen.