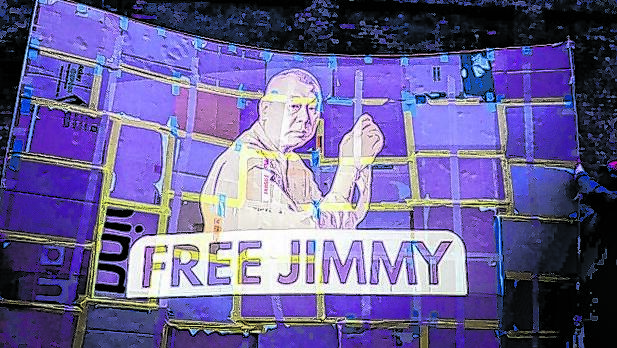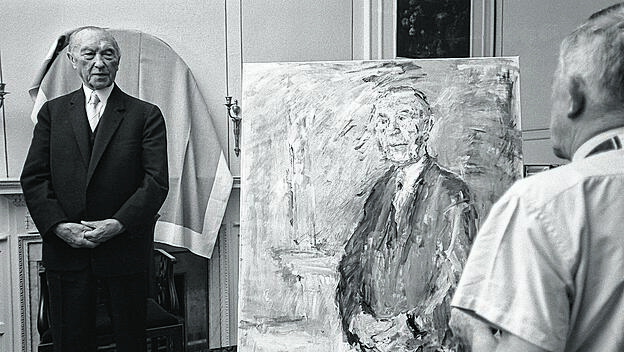Das Attentat auf einen Schulgottesdienst in der amerikanischen Stadt Minneapolis hat weltweit für Betroffenheit gesorgt. Leider, so muss man feststellen, sind derlei Gewalttaten in den USA an der Tagesordnung. Man droht abzustumpfen aufgrund der schieren Schlagzahl an Nachrichten von Amokläufen in Schulen, Einkaufszentren oder Nachtclubs. Dennoch lässt das Attentat auf die „Annunciation Catholic Church“ den Beobachter besonders fassungslos zurück. Denn es handelt sich um Kinder, die ihr Leben verloren haben, schwer verletzt und traumatisiert wurden. Das allein stellt in Amerika tragischerweise keine Seltenheit dar. Dass die tödlichen Schüsse zudem in einer Kirche fielen, noch dazu während eines Gottesdienstes, bringt die Vorstellung vom Gotteshauses als sicherem Ort, als Zufluchtsraum, ins Wanken.
Medien und Gesellschaft neigen dann doch wieder dazu, allzu schnell in die üblichen Muster zu verfallen und sich nach anfangs geäußerten Beileidsbekundungen und Gebeten wieder dem Alltag zu widmen. Doch für die Opfer, ihre Angehörigen und die Hinterbliebenen schlägt jedes Attentat eine Wunde, die wohl nie verschwinden wird. Welch diabolische Ironie steckt in der Tatsache, dass die Kinder im Gebet versunken waren, bevor die Kugeln einschlugen und den Gottesdienst in ein Blutbad verwandelten. Verständlich, dass der Bürgermeister von Minneapolis, Jacob Frey, unmittelbar nach der Tat betonte, Gedanken und Gebete seien nicht genug, Handeln sei erforderlich. Doch gerade Christen können und sollten im Angesicht solch eines fassungslos machenden Ereignisses die verbindende, heilsame Kraft des Gebets nicht unterschätzen. Zumindest wird es niemandem schaden, sich im Umgang mit Schmerz und Verlust des göttlichen Beistands zu versichern.
Transidentität des Schützen wird ausgeschlachtet
Mehr Schaden richten dann schon diejenigen an, die im Zuge des Attentats schnell wieder in ideologisches Lagerdenken verfallen. So mag es gut ins Weltbild mancher passen, dass der Täter offenbar trans war, seinen Geschlechtseintrag im Alter von 17 Jahren von männlich zu weiblich ändern ließ. Hier und da scheinen einige Portale und Akteure einen Zusammenhang andeuten zu wollen, nicht explizit, aber doch unterschwellig, nach dem Motto: Aus der Transidentität des Schützen lässt sich sein Hass auf Katholiken, Christen, Gläubige oder eine erhöhte Gewaltbereitschaft ableiten. Schließlich steht zumindest der lehramtstreue Teil der katholischen Kirche Transgeschlechtlichkeit kritisch gegenüber.
Zugegeben, auch diese Reaktion ist irgendwo verständlich. Wir leben in verwirrenden Zeiten, gerade dann ist die Sehnsucht nach der simplen Wahrheit groß. Man sucht Erklärungen für das Unerklärliche, das Unfassbare. Und man will etwas tun gegen ein Phänomen, dem man bislang immer wieder tatenlos zusehen musste. Ob eine erhöhte Skepsis gegenüber Transgender-Personen diesem Handlungsimpuls gerecht wird, sei allerdings dahingestellt. Dies bedeutet gleichzeitig nicht, dass die Transidentität des Täters unterschlagen werden soll, wie manch andere Kanäle, ob bewusst oder unbewusst, dies tun. So sieht kein seriöser, faktenbasierter Umgang mit der Tat in all ihren Facetten aus.
Ein abschließendes Urteil über die Motivation des Attentäters verbietet sich zum jetzigen Zeitpunkt, zumal aus der Ferne. Anhand der Details zur Vita und Social-Media-Aktivität des Schützen, die nach und nach ans Licht kommen und von den Ermittlern bereits bestätigt wurden, lässt sich aber erkennen: Hier handelte jemand, der offenbar massiv psychisch krank war, dessen Weltbild durchzogen war von einem wirren, abstrusen Mix aus Hass, ideologischer Verblendung und Amok- und Gewaltfantasien, die kaum auf einen stimmigen Nenner zu bringen sind. Es ist wohl nur menschlich, auch ein derartiges Übel wie die tödlichen Schüsse des Attentäters von Minneapolis einordnen, in die richtigen Schubladen sortieren zu wollen. Doch man wird akzeptieren müssen, dass nicht jeder Gewalttäter ideologisch konsistent tickt, nicht alles ins Links-Rechts-Schema passt.
Diskussion um Waffenrecht ist unvermeidlich
Noch einmal zurück zum Handlungsimpuls: Dieser ist so nachvollziehbar wie notwendig. Und auch wenn der Schütze von Minneapolis seine Waffen und Munition auf legalem Weg erworben hat: Man landet wieder einmal bei der Diskussion um das amerikanische Waffenrecht, das trotz Zehntausender Toter durch Schusswaffen jedes Jahr kaum Einschränkungen erfährt. Wer wollte dem Erzbischof von Chicago, Kardinal Blase Cupich, widersprechen, wenn er, wie jetzt nach dem Attentat, „mutige und konkrete Schritte“ fordert, um die Verfügbarkeit von Waffen zu begrenzen? Hier müsste die Politik mit dem Handeln ansetzen, doch geschehen wird wohl, wie so oft nach Attentaten und Amokläufen: nichts. Zu groß und mächtig ist die US-Waffenlobby, insbesondere nun, da Trump und die Republikaner in Washington das Sagen haben.
Dabei darf man nicht vergessen, dass jedes Attentat nicht nur Tote und körperlich Verletzte nach sich zieht, sondern zutiefst traumatisierte Menschen zurücklässt, deren Zahl die der Todesopfer noch um ein Vielfaches übersteigt. Besonders gravierend scheint dieser Aspekt, wenn es sich um Kinder handelt, die mit ansehen müssen, wie ihre Schulkameraden von Kugel getroffen und vor ihren Augen schwerverletzt werden oder sterben. Statistiken zufolge wurden fast 400.000 Kinder in den USA seit 1999 bereits Zeugen von Waffengewalt – dem Jahr, in dem mit dem Amoklauf an der Columbine Highschool in Littleton, Colorado, erstmals jene traurigen Zahlen erfasst wurden. Die Erfahrungen belasten die Betroffenen oft ihr Leben lang und sorgen beispielsweise für ein schlechteres Abschneiden in Schule und Ausbildung, im Studium oder im Berufsleben.
Der US-Präsident Donald Trump hat es jüngst sich auf die Fahnen geschrieben, Amerikas Städte sicherer zu machen. In der Hauptstadt Washington, D.C., ließ er dazu bereits die Nationalgarde patrouillieren, auch für andere Großstädte wie Chicago, New York oder San Francisco spielte er mit dem Gedanken. Viele kritisierten die Maßnahmen als unnötig oder ineffizient. Vielleicht liegt Trump nicht so falsch. Dass die USA ein Gewaltproblem haben, sollte jeder erkennen. Jetzt müsste der Präsident statt symbolischer Polizeiaufmärsche nur noch die wirklichen Problemfelder erkennen. So ernüchternd es klingen mag, womöglich gehören auch Kirchen in Zukunft zu den Orten, die gesichert werden müssen.
Die Printausgabe der Tagespost vervollständigt aktuelle Nachrichten auf die-tagespost.de mit Hintergründen und Analysen.