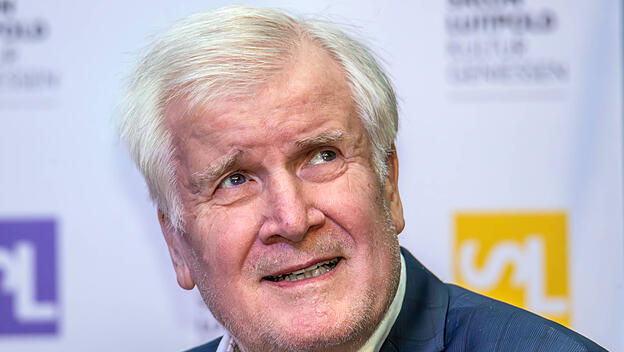Vom 5-Punkte-Plan des damaligen Oppositionsführers Friedrich Merz zur Eindämmung der illegalen Migration oder dem „faktischen Einreiseverbot“ an Tag eins ist beim heutigen Bundeskanzler Merz nicht mehr allzu viel übrig. Realpolitische Erwägungen schliffen die härtesten Ankündigungen zum Grenzschluss ab, etwa, den polnischen Nachbarn im laufenden Präsidentschaftswahlkampf nicht allzu viel Grund zu antideutscher Stimmungsmache zu geben. Und doch ist die Migrationswende so etwas wie das Pferd, auf das die CDU nach wohl weitgehend ausbleibender Wirtschafts- und Sozialwende in dieser Legislaturperiode zu setzen gedenkt.
Heute soll dazu ein kleiner Schritt im Kabinett beschlossen werden: die Aussetzung des Familiennachzugs für subsidiär Schutzberechtigte für zwei Jahre. Über diese Schiene kamen zwischen 2018 und 2024 fast 60.000 Menschen nach Deutschland, vor allem aus Syrien. Im Vergleich zur Gesamtmigration keine riesige Zahl, auch, weil sowieso nur 1000 Visa pro Monat vergeben wurden. Zwischen 2016 und 2018 war der Familiennachzug für subsidiär Schutzberechtigte, also solche, denen kein Asyl zusteht, da sie nicht wegen ihrer Religion, politischen Überzeugung oder ähnlicher individueller Merkmale verfolgt werden, schon einmal ausgesetzt. Und eingeführt wurde er auch erst 2011. Es ist also wahrlich nicht die ganz große Stellschraube, an der Innenminister Dobrindt jetzt – wie im Koalitionsvertrag vereinbart – drehen will.
Integration geht leichter mit weniger Migration
Die deutsche Bischofskonferenz (DBK) hat sich trotzdem in den Kreis der Mahner eingereiht, die der CDU nun mehr oder weniger direkt einen Mangel an „Nächstenliebe“ (so der Grünenpolitiker Marcel Emmerich) attestieren. Seitens der DBK greift man zu abgewogeneren Worten, verficht weiterhin einen angesichts der zuletzt zunehmenden Kritik durchaus stoisch zu nennenden Kurs: Auch diese Einschränkung sehe er sehr kritisch, sagte der Hamburger Erzbischof und DBK-Flüchtlingsbeauftragte Stefan Heße den Zeitungen der Neuen Berliner Redaktionsgesellschaft am Dienstag. Denn Bürgerkriegsflüchtlinge müssten dann längere Zeit getrennt von ihren engsten Familienmitgliedern leben, was ethisch überaus fragwürdig sei und sich und auch negativ auf die Integration auswirke. Das Grundgesetz stelle die Familie unter besonderen Schutz der staatlichen Ordnung. „Dieses Schutzversprechen gilt für alle Familien in unserem Land – auch für schutzsuchende Familien“, so Heße.
Wahre Worte, und auch schön, dass sich katholische Bischöfe für Familien einsetzen. Und doch bleibt wie so oft der Eindruck, dass etwas mehr differenzierender Weitblick der ethischen Wegweisung auch keinen Abbruch tun würde. Denn was sich ebenfalls negativ auf die Integration auswirkt, ist zu viel Migration. In Schulklassen, in denen nur noch wenige oder gar keine deutschen Kinder mehr sitzen, wird es mit der Integration halt auch nicht einfacher. Insofern stärkt es die Integration, wenn die Migration reduziert wird. Mit mehr Geld allein, in der DBK-Diktion „Unterstützung“, wie Heße sie gerade beim neunten katholischen Flüchtlingsgipfel forderte, lässt sich Integration hingegen nicht herstellen.
Man wünschte sich, die DBK ließe solche Gedanken ab und an zu. Dass Vielfalt auch Stress bedeutet. Dass eine Migrationspolitik politisch langfristig tragbar, das heißt vom Souverän akzeptiert sein muss. Dass Sozialarbeiter und Sozialetats nicht vom Himmel fallen. Das heißt alles nicht, dass es nicht Job der Bischöfe wäre, gerade auch bei politischem Gegenwind für christliche Ideale einzustehen. Sondern nur, dass die Relevanz bischöflicher Interventionen wohl größer sein könnte, wenn der Blick auf die Realität etwas weniger verengt erschiene.
Die Printausgabe der Tagespost vervollständigt aktuelle Nachrichten auf die-tagespost.de mit Hintergründen und Analysen.