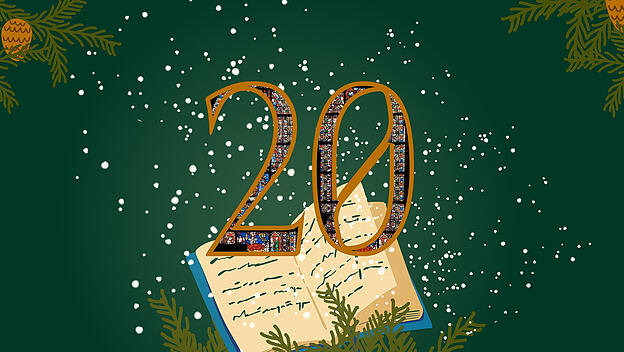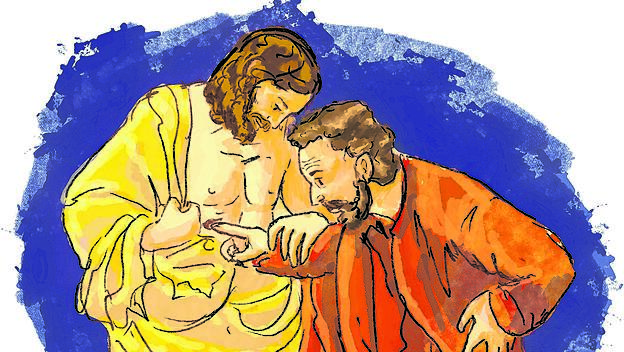In seinem schönen und dankenswerten Bericht vom 12.11.2025 „Die liberale Flamme flackert“ über die Liberalismuskonferenz des Thinktanks R21 vom 11. November hat Sebastian Sasse einige meiner Aussagen an der Konferenz leider nicht ganz korrekt wiedergegeben. So zunächst meine Bemerkung in einer Podiumsdiskussion, dem liberalen Begriff der Religionsfreiheit liege das spezifisch christliche Verständnis von Religion zugrunde: Diese meinte nicht, wie „Die Tagespost“ berichtete, „im Christentum gebe es nicht das Ziel Staatsreligion zu werden“ (und zwar im Unterschied zum Islam, wo das der Fall sei). Das geht am entscheidenden Punkt vorbei.
Meine Aussage war, dass das Christentum die erste und bisher auch einzige Religion der Weltgeschichte ist, die aus ihren heiligen Texten – also der Bibel – keine Rechts-, Sozial- und politische Ordnung ableitet. Vielmehr ist dem Christentum und war der katholischen Kirche von Anfang an die Unterscheidung von „geistlicher“ und „weltlicher“ Sphäre, von Religion und Politik wesentlich.
Weltliche Herrscher schufen das Reichskirchensystem
Als das Christentum im Römischen Reich zur dominierenden Religion wurde, hat es das römische Recht übernommen, die politische Ordnung des römischen Kaisertums weitergeführt und in seiner Theologie nach und nach die sogenannten „griechischen Wissenschaften“ assimiliert, ja es hat diese, vor allem durch arabische Christen, an die islamische Kultur weitergegeben, die sie dann aber, im Unterschied zu den kirchlichen Universitäten, im Laufe des Mittelalters aus ihren Schulen und deren Curricula verbannte.
Zahlreiche, nicht zu leugnende Vermischungen von weltlicher und geistlicher Gewalt im Laufe des Mittelalters und in der früheren Neuzeit gingen gerade nicht von der Kirche als geistlicher Gewalt, sondern von den weltlichen Gewalten, der Politik, aus. Die Erhebung des Christentums zur Staatsreligion im Jahre 382 unter Kaiser Theodosius geschah aus Gründen der typisch römisch-imperialen Machtideologie und eben gerade nicht aus der Mitte und als Forderung der christlichen Theologie.
Im frühen Mittelalter war es nicht die Kirche, sondern waren es die weltlichen Herrscher seit Karl dem Großen, die das Reichskirchensystem schufen. Im Hochmittelalter war es dann die Kirche unter Gregor VII., die in der sogenannten Päpstlichen Revolution dieses System zerschlug und erneut auf die klare Scheidung von geistlicher und weltlicher Gewalt, von Religion und Politik, pochte, wie sie bereits im Evangelium angelegt ist: „Gebt dem Kaiser, was dem Kaiser, und Gott, was Gott gehört“.
Der Islam ist eine politische Religion
Just diese Unterscheidung hat es im Islam nie gegeben, er enthält in seinen heiligen Texten eine Rechts- und Sozialordnung – beziehungsweise leitet eine solche daraus ab –, ist also in seinem Kern, ja im eigentlichen Sinne, eine „politische Religion“. Dem Islam geht es ganz wesentlich um die rechtliche und politische Gestaltung der irdischen Gemeinschaft, die so, wie sie im islamischen Recht, der Scharia, grundgelegt ist, integraler Bestandteil des Islam als Religion ist. Hinsichtlich ihres Verständnisses von Politik, Recht, bürgerlicher Freiheit usw. sind Christentum und Islam deshalb theologische Antipoden und, was das Verständnis von „Religion“, damit aber auch von menschlicher Gesellschaft und „Staat“ betrifft, unvereinbar.
Der freiheitliche, säkulare Rechtsstaat und damit auch die liberale Demokratie sind auf dem Humus des Christentums und seiner Scheidung von „geistlicher“ und „weltlicher“ Gewalt entstanden; der theologische Gegenspieler einer freiheitlichen, säkularen und demokratischen politischen und rechtlichen Ordnung ist theologisch gesehen der Islam. So konnte sich das Zweite Vatikanische Konzil gerade mit Berufung auf das Evangelium und die Lehre der Apostel, also in Berufung auf das ursprüngliche Charisma des Christentums, die Religionsfreiheit als bürgerliches Recht anerkennen, ohne sich dadurch als Religion mit einem entsprechenden Wahrheitsanspruch und seinem Heilsangebot aufzugeben.
Religionsfreiheit gründet auf dem christlichen Verständnis
Genau dazu ist der Islam theologisch nicht imstande: Geht er auf seine Ursprünge zurück, gelangt er zur Ordnung von Medina, einer rechtlich-politisch-religiösen Einheitsordnung, in der zudem die Legitimierung von Gewalt gegenüber Ungläubigen grundgelegt wurde. Die islamische Kairoer Erklärung der Menschenrechte stellt deshalb konsequenterweise alle bürgerlichen Rechte unter den Vorbehalt der Bestimmungen der Scharia, lehnt also eine säkulare, freiheitliche Rechtsordnung ab. Nur eine islamische Rechts- und Sozialordnung, nur ein islamisches politisches System, das „Haus des Islam“, ist, was seine theologische Substanz betrifft, für den Islam auch als Religion denkbar.
Deshalb kann im säkularen Rechtsstaat und in einer von ihm geprägten liberalen Demokratie „Religionsfreiheit“ den Muslimen nur als bürgerliches Grundrecht gewährt werden, nicht aber in den Aspekten, die ihn in Konkurrenz zum säkularen, freiheitlichen Rechtsstaat setzen. Auf dieser Ebene können Muslime loyale Staatsbürger sein, ihre eigenen Traditionen pflegen und im Frieden mit Nichtmuslimen zusammenleben. Und das tut auch eine große Mehrheit bestens integrierter Muslime in westlichen Staaten. Doch das ändert nichts an der Tatsache, dass die spezifisch islamische Rechts- und Sozialordnung aus Sicht des säkularen, freiheitlichen Rechtsstaates und der liberalen Demokratie verfassungsfeindlich und eine entsprechende Gefahr ist, sollte sie von einer Mehrheit unserer muslimischen Mitbürger im Namen der Religionsfreiheit durchgesetzt werden wollen.
Denn gerade diese verfassungsfeindlichen, antiliberalen und mit dem säkularen Rechtsstaat unvereinbaren Elemente gehören – im Unterschied zum Christentum – dem Selbstverständnis des Islam gemäß zentral zu seinem Wesen als „Religion“. Deshalb meine Aussage, unserem Begriff von Religionsfreiheit liege der christliche Begriff von Religion zugrunde. Die Brisanz davon ist: Wird das nicht anerkannt, sind wir bei steigendem muslimischem Bevölkerungsanteil gegenüber der Unterwanderung unserer Rechtsordnung durch das islamische Recht politisch machtlos. Vor allem, wenn wir einen Verfassungsschutz haben, der eine solche Kritik am Islam absurderweise als verfassungswidrig erklärt, da sie angeblich gegen die Menschenwürde unserer muslimischen Mitbürger verstößt. Dümmer geht es nicht mehr.
Wirtschaftliche Freiheit ist von grundlegender Bedeutung
Der zweite Punkt, in dem „Die Tagespost“ meine Ausführungen nicht richtig wiedergab, betrifft meine Kritik an der Unterscheidung von bürgerlicher und wirtschaftlicher Freiheit. Ich habe diese Unterscheidung mit dem Argument kritisiert, dass gerade im liberalen Verständnis die wirtschaftliche Freiheit ein grundlegendes bürgerliches Recht ist, davon also nicht „unterschieden“ werden kann. Dabei habe ich nicht behauptet, „alles menschliche Handeln sei letztlich wirtschaftliches Handeln“. Meine Aussage war: Im bürgerlichen Bereich, also in der Ausübung unserer bürgerlichen Freiheitsrechte, sei gerade die wirtschaftliche Freiheit von grundlegender Bedeutung.
Sie ermöglicht es, unternehmerisch tätig zu sein, aber auch auf dem Arbeitsmarkt oder etwa bei Entscheidungen für die eigene Ausbildung und berufliche Ausrichtung, frei, ohne Gängelung durch den Staat zu agieren. Im gesellschaftlichen Raum hat deshalb – ganz abgesehen von ökonomischer Tätigkeit im engeren Sinn – all unser Handeln beziehungsweise haben alle unsere Lebensentscheidungen immer auch eine wirtschaftliche Komponente und sind Ausübung des bürgerlichen Rechts der wirtschaftlichen Freiheit.
Das heißt aber nicht, es gebe im Leben eines Menschen nicht auch Handlungen, die keiner wirtschaftlichen Logik folgen, etwa im Rahmen der Familie, freundschaftlicher oder nachbarschaftlicher Beziehungen usw. Ja, ganze Berufszweige verlaufen nicht nach ökonomischen Gesichtspunkten. Zudem sind Teilen, Schenken, Almosen geben, Verzeihen und vieles andere mehr ebenfalls keine wirtschaftlichen Handlungen. Mir die Aussage, „alles menschliche Handeln sei letztlich wirtschaftliches Handeln“ in den Mund zu legen, ist also irreführend.
Der Autor war Universitätsprofessor für Ethik und politische Philosophie an der Päpstlichen Universität Santa Croce in Rom; gegenwärtig ist er Präsident des „Austrian Institute of Economics and Social Philosophy“ mit Sitz in Wien.
Die Printausgabe der Tagespost vervollständigt aktuelle Nachrichten auf die-tagespost.de mit Hintergründen und Analysen.