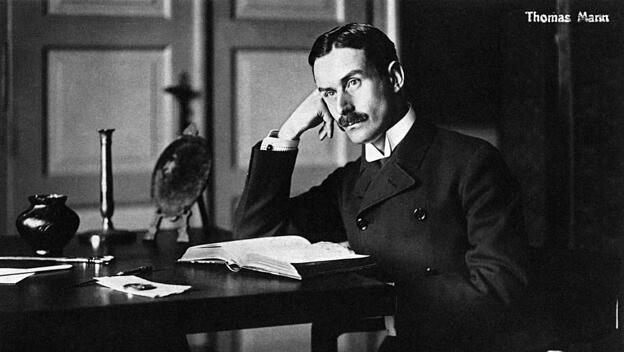Dem japanischen Spieleentwickler FromSoftware ist gelungen, was im heutigen Kulturbetrieb eine Seltenheit darstellt: Mit der „Dark Souls“-Reihe (2011-2016) wurde eine Marke mit Kultstatus geschaffen. Die düsteren Fantasy-Rollenspiele ragen mit ihrer gleichermaßen atemberaubenden wie abstoßenden Ästhetik, ihren spektakulären Kämpfen und einem einzigartigen Schwierigkeitsgrad aus dem Videospielmarkt heraus. Über 35 Millionen Exemplare wurden bislang allein außerhalb Japans verkauft. Inzwischen spricht man von „Soulslike“ gar als eigenem Genre. Der Nachfolger der Reihe, „Elden Ring“ (2022) und seine Erweiterung „Shadow of the Erdtree“ (Schatten des Erdenbaumes, 2024), stehen dem in nichts nach, wovon neuerliche Verkaufsrekorde und die Auszeichnung zum Spiel des Jahres 2022 (The Game Awards) künden.
Wer selbst noch in die „Zwischenlande“, die Welt des Fantasy-Rollenspiels Elden Ring, eintauchen möchte, der möge den folgenden Teil tunlichst überspringen. Denn hier folgt sogleich die entscheidende Wendung der Geschichte: Marika, die zentrale weibliche Figur im Spiel, und Radagon, ihr männliches Pendant, sind ein und dieselbe Person. Ganz recht, der mysteriöse rothaarige General und die ewige göttliche Königin – Radagon ist Marika. Und damit nicht genug: Auch Marikas Sohn Miquella, Dreh- und Angelpunkt der Erweiterung, hat eine männliche und eine weibliche Seite. Auf seinem Weg zur Gottheit vermählt der zu ewiger Jugend Verfluchte sich obendrein mit seinem Halbbruder.
Nicht schon wieder, möchte man klagen. Nicht das nächste Stück Gegenwartskultur, das den Konsumenten mit der Normalisierung aller möglichen Neigungen und Geschlechteridentitäten einlullt. Nicht das nächste „woke“ Produkt, seit unter anderem Disney sich bemüht, seine „keineswegs geheime homosexuelle Agenda“ in Filme und Serien einzuflechten. So zumindest formulierte es die Produzentin Latoya Raveneau einmal intern.
Doch dieser Zeitgeist weht durch Elden Ring bei näherem Hinsehen nicht. Zu diesem Urteil kommt auch Zack Hoyt alias „Asmongold“, einer der weltweit bekanntesten Videospiel-Streamer. Der libertär bis konservativ gesinnte Texaner stellte, am Ende des Spiels angelangt, fest, „dass wir es hier im Kern mit einem Trans-Charakter und einer homosexuellen Beziehung zu tun haben – und trotzdem niemand dieses Spiel als „woke“ bezeichnen kann. In der Tat: Elden Ring schürt nicht Sympathie für „fluide“ Geschlechteridentitäten, sondern illustriert anhand dieser Konfusion die Konflikte und Dramatik der Spielwelt. Die betreffenden Charaktere taugen also gerade nicht zur Identifikation, weil erstens Dunkelheit und Widersprüche ihre Lebensläufe prägen. Zweitens scheitern sie mit ihren Ambitionen grandios und verursachen dadurch unsägliches Leid. Das macht sie wiederum, drittens, zu den Hauptantagonisten des Spielers. Diese drei Aspekte seien nachfolgend ausgeführt.
Bilder des Scheiterns
Die Biografien der tragischen Figuren um Königin Marika und ihren Sohn Miquella erweisen sich als obskur, mindestens verwirrend, oft empörend und teils gar wahnsinnig. So scheint Marika ihre männliche Hälfte Radagon für Intrigen zu „nutzen“, indem dieser etwa eine verfeindete Herrscherin verführt. Wie aus der „Verbindung“ von Marika und Radagon obendrein mehrere Kinder, darunter Miquella, hervorgehen, bleibt ein Rätsel.
Letzterer wiederum entledigt sich im Zuge seiner Apotheose Stück um Stück seines Fleisches –der Anblick bleibt dem Spieler zum Glück erspart – und auch seiner weiblichen Hälfte, genannt seiner „Liebe“. Es sei dahingestellt, ob die Assoziation zu „geschlechtsangleichenden“ Operationen beabsichtigt war. Jeder Beobachter erkennt aber: Was diese selbstgemachten Götter mit ihren Körpern und Seelen anstellen, ist vor allem eines – unmenschlich und damit alles andere als erstrebenswert.
Doch nicht nur das: Ihr Streben nach Unsterblichkeit und grenzenloser, ja göttlicher Macht wird Marika und Miquella zum Verhängnis. Ihre Ambitionen scheitern an Selbstüberschätzung und Naivität. Marika, die ursprünglich das Leiden ihres Volkes rächen und den Tod selbst aus der Welt verbannen wollte, lässt nach und nach jede Menschlichkeit fahren. Sie stürzt die Lande, über die sie herrscht, in Chaos, Leere und Gewalt. Ihre Untertanen sterben nicht, doch leben sie auch nicht wirklich. Sie wandeln, kaum mehr als Hüllen, nur noch ziellos durchs Land.
Miquella ist – vor allem angesichts der Schneise des Leidens, die seine Mutter geschlagen hat – getrieben vom naiven Wunsch, „die Welt zu einem gütigeren Ort zu machen“. Doch auch er, der „ewige Teenager“, glaubt, das nur allein bewerkstelligen zu können. Dafür benötigt auch er unbegrenzte Macht. Dabei zwingt er jedem, den er in seinem Weg wähnt, buchstäblich seinen Willen auf. Das gleiche macht er mit seinem Halbbruder, den er sich als Fürsten und Gemahl ausersehen hat.
Ein Motiv zieht sich durch alle Welten von FromSoftware: Wer sich ausschließlich von erfahrenem Unrecht oder dem Durst nach Rache leiten lässt, wird nichts als endloses Leid hervorbringen. Dieses Los ereilt schließlich auch Marika und Miquella selbst – in Gestalt des Spielers, der die beiden als finale Gegner in Hauptspiel respektive Erweiterung niederstreckt. Doch auch das gehört zur typischen Ironie der „Soulslikes“: Der Spieler, nun Fürst der Zwischenlande, herrscht nach all seinen Schlachten letztlich über ein Nichts.
Welten ohne (wahren) Gott
Es gibt gute Argumente dafür, als Christ am besten ganz die Finger von derlei Unterhaltung zu lassen. Gerade für im Glauben weniger gefestigte Gemüter besteht die Gefahr, von der Faszination des Dunklen und der rohen Macht überwältigt zu werden.
Wer aber das Abstoßende dieser Fantasien vor Augen behält, für den können sie überaus lehrreich sein. Denn sie zeichnen in einmaliger, bildgewaltiger Weise Welten ohne (wahren) Gott. Darin ist nur mehr Platz für Intrigen, Rache und Gewalt. Die Zwischenlande von Elden Ring bilden gewissermaßen eine moderne künstlerische Umsetzung der Welt der „letzten Menschen“ aus Nietzsches Zarathustra, die nur noch sinnlos dahinvegetieren. Und – im Gegensatz zu Nietzsche – zeigen sie sogar in letzter Konsequenz, welches Schicksal der kleinen Schar an vermeintlichen „Übermenschen“ mit ihrem totalen „Willen zur Macht“ bestimmt ist.
Die Printausgabe der Tagespost vervollständigt aktuelle Nachrichten auf die-tagespost.de mit Hintergründen und Analysen.