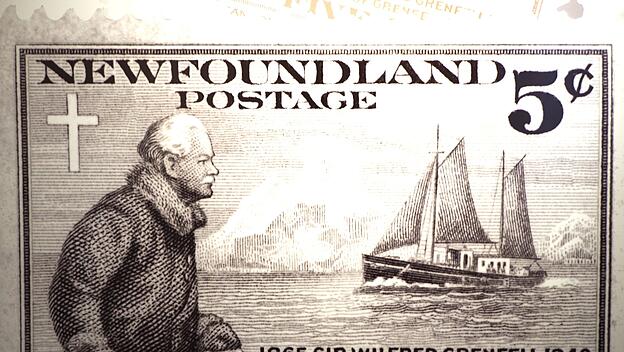Charles Causley (1917–2003) gehört zu jenen Dichtern, deren Werk sich einer bequemen Etikettierung entzieht. Das scheint an sich kein Schade zu sein, hat aber den Nachteil, dass die Literaturkritik – zumindest im Vereinigten Königreich – dazu neigt, ihm weniger Aufmerksamkeit zu widmen als Autoren, die scheinbar griffbereit in Schubladen unterzubringen und literarhistorisch einzuordnen sind. Wohin gehört Causley? Ein Blick in diverse biographische Abrisse offenbart die Verlegenheit, die es bereitet, ihn als einen Dichter der „Moderne“, als selbstbewussten Avantgardisten verstehen zu wollen. Was ihn betrifft, so hätte es der „konservativen Revolution“ der zwanziger Jahre, der Dichtung des späteren Nobelpreisträgers T. S. Eliots, nicht bedurft. Was allerdings zur Folge hatte, dass er nicht in die 1965 neu aufgelegte, ursprünglich von Eliot angeregte Standardanthologie „The Faber Book of Modern Verse“ aufgenommen wurde. Zwar wird Causleys Name nicht genannt, doch nur ihn kann der Herausgeber Donald Hall im Sinn gehabt haben, wenn er schreibt: „Ich konnte nicht umhin, einen von mir bewunderten Lyriker auszulassen, denn seine besten Gedichte sind Balladen, die ihre alten Vorbilder ins Gedächtnis rufen, und es wäre allzu absurd gewesen, diese als ,modern‘ ansehen zu wollen.“
Ein Dichter, der nur schwer einzuordnen ist
Ein solches Bekenntnis sagt, wie der Herausgeber selbst impliziert, viel über ein inzwischen überholtes Verständnis der „Moderne“ aus, wenig über den Rang von Causleys Dichtung. Wie immer man den Begriff „modern“ interpretieren mag: Mit Recht weist Hall darauf hin, dass Causleys Lyrik primär in den englisch-schottischen Volksballaden, darüber hinaus den Sagen und historischen Legenden seiner kornischen Heimat wurzelt. Und wenn er sich älteren Zeitgenossen überhaupt verbunden fühlt, so sind dies Rudyard Kipling mit seinen Erzählgedichten, sein väterlicher Freund und Förderer Siegfried Sassoon mit Gedichten aus der Zeit des Ersten Weltkriegs sowie Roy Campbell mit seiner geschliffenen Naturlyrik – drei Dichter übrigens, denen ebenfalls Eingang in das „Faber Book“ verwehrt wurde, weil sie, anders als die Modernisten und ihre Epigonen, der Versuchung widerstanden, Satzbau und Versmaß der englischen Sprache einer Belastungsprobe zu unterziehen. Die Ballade als Form, der Krieg als Thema: Dies sind, von nur wenigen wichtigen Ausnahmen abgesehen, die wichtigsten Konstanten von Causleys mehr als ein halbes Jahrhundert (1944–2000) umspannenden lyrischen Produktion. Heute gilt er als ein „Dichter des Volkes“ (Ted Hughes), und Richard Humphrey hat ihn treffend als den vielleicht „englischsten der englischen Dichter des 20. Jahrhunderts“ bezeichnet.
Wie dem großen Romantiker John Keats, dem er eines seiner ersten und besten Gedichte gewidmet hat („Keats at Teignmouth“), war ihm sein künstlerisches Talent, nicht aber der spätere Erfolg in die Wiege gelegt worden. Causley wurde 1917 in Launceston (Cornwall) als einziges Kind einer Arbeiterfamilie geboren. Sein Vater kehrte als Invalide aus den Schützengräben des Ersten Weltkriegs zurück und starb 1925. Sein Tod und die Folgen– dass seine Mutter das nächste halbe Jahrhundert ihren Lebensunterhalt als Putzfrau und Wäscherin verdienen musste – öffneten ihm den Blick für die Leiden der Kriegsgeneration und die daraus resultierende Not der arbeitenden Bevölkerung. Immer wieder findet sich in seiner Lyrik ein gesellschaftskritischer Unterton, der in seiner Schärfe gelegentlich an Brecht und die sozialistisch orientierten englischen Dichter der dreißiger Jahre erinnert. Siegfried Sassoon mit seinen „Telegrammen von der Ostfront“ war es, der ihn aus der nebulösen Welt der spätviktorianischen Lyrik herausgeholt und ihm Einblick in das Kriegsgeschehen gewährt habe. Gern zitierte er Sassoons Verse: „Ich wünschte, ein Panzer käme durch das Publikum geruckelt,/ Dann gäb's keine dummen Witze mehr im Tingeltangel.“
Der Zweite Weltkrieg nahte, und Causley, die Metapher von Sassoons Gedicht aufgreifend, wurde schnell klar, dass es ihm nicht vergönnt sein werde, „den Ereignissen im Logenplatz beizuwohnen“. 1939 wurde er zur Marine gezogen und verbrachte die nächsten sechs Jahre auf Zerstörern und Flugzeugträgern, schrieb seine Gedichte auf Papierschnitzel, um dann als Lehrer in seiner alten Schule alle Fächer mit Ausnahme des verhassten Faches Sport zu unterrichten („dreißig Jahre in Kalksibirien“). Die knapp bemessene Freizeit war dem Dichten vorbehalten.
Der Krieg und die mit ihm verbundenen Motive des gewaltsamen Todes, der Sehnsucht nach der Heimat und der Familie sowie dem daraus resultierenden Verlust der Unschuld blieben bis an sein Lebensende ein beherrschendes; in seinen ersten beiden Lyrikbänden waren sie sogar das ausschließliche Thema. Wie Sassoon hatte er die Erfahrung gemacht, dass sich physischer Schmerz und seelisches Leid der literarischen Gestaltung entziehen, dass es sich nur skizzenhaft umreißen oder mit Hilfe ausdrucksstarker Bilder und Symbole andeuten lässt. Ein Dichter, so seine Überzeugung, müsse den Leser dazu zwingen, zwischen den Zeilen zu lesen und aus eigener Erfahrung zu ergänzen, was der Dichtkunst auszudrücken grundsätzlich versagt ist. Jedes Gedicht trage ein Rätsel in sich; Aufgabe des Dichters sei es, das Rätsel vorzutragen, Aufgabe des Lesers hingegen, sich an einer Lösung zu versuchen. Gern zitierte er in diesem Zusammenhang W. H. Auden: Ein Gedicht dürfe bestenfalls erhellen, nicht aber dekretieren. Das vielleicht wichtigste und für uns interessanteste Rätsel, das nicht nur seine Lyrik, sondern er selbst aufgibt, ist die Gretchenfrage: Wie hält er es mit der Religion? Diese Frage hat auch die Literaturkritik beschäftigt. 1983 wurde er während einer Deutschlandreise in einer Schulfunksendung eher allgemein und mit angelsächsischer Diskretion in diesem Sinne ausgeforscht. Es stecke doch, so befand sein Gesprächspartner, „ein gutes Stück Christentum“ in ihm. Causleys Antwort: „Ich halte mich nicht für einen Christen. Ich bin in christlicher Tradition erzogen worden und habe die christliche Kultur aufgenommen... und ich bin dankbar für die Bibel, dieses großartige Geschenk, das meiner schöpferischen Begabung förderlich gewesen ist. Um keinen Preis würde ich dies missen wollen. Andererseits lässt die institutionalisierte Religion mir das Blut in den Adern gefrieren.“
Eine harte, fast feindselige Absage an das Christentum also? Es könnte so scheinen: Die Kirche als Mutter der Imagination, die man zurückstößt, sobald sie der eigenen Kunst nicht mehr dienlich ist. Und dennoch: Der prägnante erste Satz bereits macht misstrauisch: „Ich halte mich nicht für einen Christen.“ Das schließt nicht aus, dass er doch einer sein könnte, wenn auch nicht dem eigenen Verständnis nach. Doch weiter: So ehrlich die Antwort ist, es ist nicht die einzige. Einige Jahre später wurde ihm im Rahmen eines Interviews die gleiche Frage gestellt, und diesmal lautete die Antwort so: „Ich bin mir nicht ganz im Klaren über meine Position als religiöser Dichter, auch wenn einige Leute mich als solchen bezeichnen.“ Folgen wir also der Empfehlung von D. H. Lawrence: Vertrauen wir nicht dem Dichter, sondern seiner Dichtung. Und wenn wir dies tun, erleben wir eine Überraschung. Schon der Literaturkritik ist aufgefallen, dass er die für die ersten Lyrikbände charakteristische Themenpalette in der 1957 erschienenen dritten Sammlung „Union Street“ überraschend um die christlicher Themen anreichert. Wie kommt es dazu? Zwar hat ihn die Frömmigkeit seiner Mutter stark geprägt: Er hat sie bis in ihr hohes Alter gewissenhaft zum Sonntagsgottesdienst gefahren. Ihren Glauben hat er, eigenem Bekunden zufolge, nicht bewahrt – jedenfalls nicht mit der ihr eigenen Konsequenz. Eine Vermutung mag weiterhelfen. 1955 machte Causley während der Schulferien eine Reise nach Frankreich, die ihn zu zwei seiner bekanntesten Gedichte inspirierte. Die Inschrift auf einem Kreuz in Lisieux regte ihn zu seinem Sonett „Ich bin die große Sonne“ („I Am the Great Sun“), der Besuch von Gräbern englischer Weltkriegssoldaten zu dem surrealistischen Erzählgedicht „Auf dem Soldatenfriedhof von Bayeux“ an. In beiden Fällen handelt es sich um Meisterwerke, die ohne den Rückgriff auf Motive des Neuen Testaments nicht hätten geschrieben werden können. Das Sonett ist eine kongeniale Wiederbelebung des im Mittelalter beliebten Genres der Christus-Klage.
Der Erlöser wirbt darin in menschlicher Gestalt und als Verkörperung der christlichen Tugenden um die Liebe und Treue des gefallenen Menschen. Causley greift auf die durch Shakespeare populär gewordene Form des Sonetts zurück, dessen Schlussverse in einer epigrammatisch zugespitzten Wendung gipfeln. Und in der Tat wartet das Distichon mit einem wohldosierten Schock für die Anhänger der Allerlösungstheorie auf: „Ich bin dein Leben, doch wenn du mich nicht nennen willst,/ versiegle deine Seele mit Tränen, und gib mir niemals die Schuld [an deinem Schicksal].“ Dies ist keine Marotte des Dichters, sondern eine poetisch geraffte Variation der bekannten Matthäus-Stelle 10, 32f.: „Wer sich vor den Menschen zu mir bekennt, zu dem werde auch ich mich bekennen vor meinem Vater im Himmel. Wer mich aber vor den Menschen nicht kennen will, den werde auch ich am Gerichtstag vor meinem Vater im Himmel nicht kennen.“ Vor diesem Hintergrund ist es kein Wunder, dass ein namhafter deutscher Anglist sich zu der Bemerkung hinreißen ließ, dies sei die Glanzleistung eines Katholiken. Nur war ihm das gleichzeitig entstandene Erzählgedicht nicht bekannt, das Causley seinem Sonett in der gleichen Absicht an die Seite gestellt haben dürfte, wie Goethe seinen gotteslästerlichen „Prometheus“ dem frommen „Ganymed“. Auch im Erzählgedicht ist zwar von der Hoffnung auf Erlösung die Rede, doch hier wird sie gründlich enttäuscht. Die Erlösung, so versichern die Toten dem betenden Friedhofsbesucher, sei eine Illusion. Sie fordern ihn auf, „verschwenderisch mit seiner Liebe“ umzugehen, denn: „Die einzige Gabe, die wir erbitten, ist die Gabe, die du nicht geben kannst.“ Der Sprecher wird aus der Transzendenz in sein irdisches Dasein verwiesen. Die Kluft zwischen den Toten und den Lebenden kann nicht überbrückt werden.
Religiöse Überzeugungen nahm Causley sehr ernst
Der scheinbare Widerspruch zwischen der Aussage des Sonetts und der des Erzählgedichts verschwindet, wenn wir bedenken, dass es sich weder im einen noch im anderen Fall um Bekenntnislyrik handeln muss. Zudem wählt Causley im Sonett – im Gegensatz zum Bayeux-Gedicht – nicht die Perspektive des Menschen, sondern die des Schöpfers: Nicht der Dichter spricht also zu uns, sondern Christus als „Licht der Welt“ (Joh. 8, 12). Wie ernst Causley religiöse Überzeugungen nahm, konnte ein katholischer Student erleben, der zu Beginn der achtziger Jahre mehrere Monate als sein Sekretär fungierte. Als der eines Sonntags beim Blick durchs Fenster feststellte, dass ein Schauerregen niederging, legte er seine Jacke wieder ab, ließ sich im Wohnzimmer auf einen Sessel fallen und erklärte, auf den Besuch des Gottesdienstes verzichten zu wollen. Causley sah ihn an, als hätte er nicht recht verstanden. Als sein Gast lachend die Beine von sich streckte, schwoll ihm die Halsader an, und er explodierte: Was das für ein Glaube sei, der von einem bloßen Wetterumschwung weggespült werde? Der junge Mann war sofort wieder auf den Füßen und versicherte, es sei nur ein Scherz gewesen. In Glaubensdingen, so Causley, gebe es nichts zu scherzen – es gebe nur ein klares Bekenntnis oder gar keines. Dies war die prosaische Variante des Sonetts. Und Causley zog die Konsequenz. Er rief ein Taxi und schärfte dem Fahrer ein, seinen Freund bis vor die Kirchentür zu fahren.
Die Anekdote mag die Intensität seiner religiösen Lyrik erklären – wie anders denn als religiös sollte man ein Sonett wie „Ich bin die große Sonne“ nennen? Klarer noch als an den beiden aufgeführten Beispielen zeigt sich seine Intensität des Empfindens an dem Gedicht „At the Church of St Anthony, Lisbon“ (1981). Hier spricht er ausnahmsweise in eigener Sache. Dabei handelt es sich, gewiss unabsichtlich, um eine Kontrafaktur von Philip Larkins bekanntem Gedicht „Church Going“. In beiden Fällen betritt der agnostische Sprecher eine Kirche: Larkin in Irland, Causley in Portugal. Während Larkin sie als der verlässt, der in sie eingetreten ist, verlässt Causley sie als ein Gewandelter, der mit den Versen schließt: „Keine magische/ Botschaft aus Padua; die ungeläuteten Glocken/ schlingern schweigend hoch über meinem Kopf./ Sankt Antonius, unser Vater, ist nicht tot.“ Zumindest mit diesem poetischen Zeugnis erweist sich Causley als christlicher Dichter wider Willen.