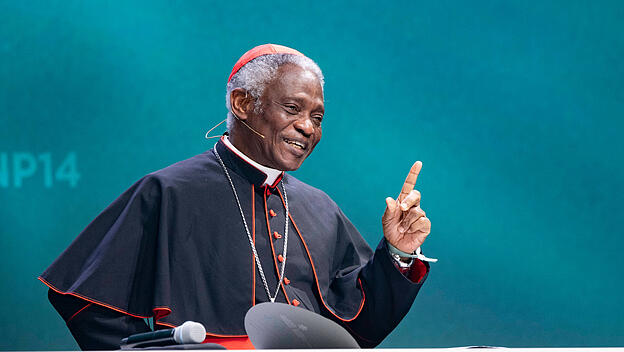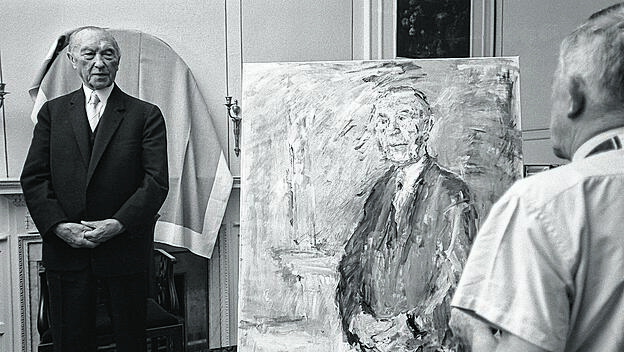Der Paderborner Moraltheologe Peter Schallenberg ordnet die Möglichkeiten, Künstliche Intelligenz in der Theologie einzusetzen als sehr überschaubar ein und sieht sie als „rein instrumentelle Hilfe oder Assistenz“. Die Predigt solle eine authentische, mit einem Glaubenszeugnis verbundene Auslegung sein, sagte er im Gespräch mit dieser Zeitung. Wörtlich erklärte Schallenberg: „Der eigentliche Sinn der Predigt ist nicht das Vorlesen künstlich erzeugter Texte, sondern die Mitteilung eigenen Nachdenkens und kirchlicher Lehre!“. In der Seelsorge sei mit KI „so gut wie nichts anzufangen. Die Seele ist etwas, das KI nicht kennt und nicht nachempfinden kann.“. Als Beispiel für die Grenzen der KI führte der in Paderborn lehrende Moraltheologe die Beichte an. Die Anwesenheit eines Menschen sei in der Seelsorge nicht zu ersetzen.
KI als Hilfe für Information
Schallenberg schloss nicht aus, dass KI eine Hilfe sein könne, um sich über den Glauben zu informieren oder um einen Zugang zur Heiligen Schrift zu finden. Menschen könnten durch KI auf die Idee kommen, sich näher mit der Bibel und den Geboten der Kirche zu befassen. Zugleich schränkte er die Perspektive auf eine persönliche Beziehung zu Gott via KI ein: „Aber von der Person des lebendigen Gottes, von der Person Jesu Christi, fasziniert zu sein durch KI, das ist ähnlich wie in einer KI-basierten Partnerbörse nach dem einen Menschen zu suchen, in den man sich verlieben kann.“ DT/reg
Im „Thema der Woche“ der kommenden Ausgabe der „Tagespost“ erfahren Sie mehr zur Schnittstelle von Künstlicher Intelligenz und Seelsorge.