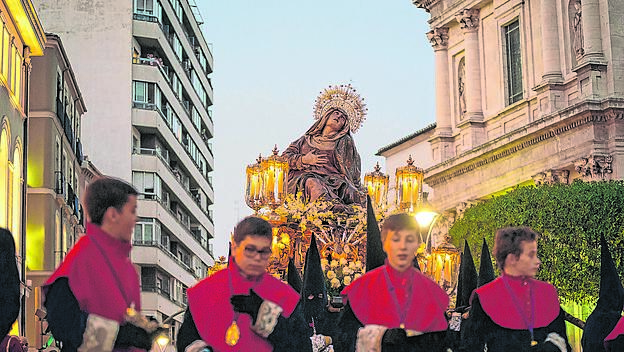Ende September hat der „Caritasverband der Erzdiözese München und Freising e.V.“ einen Fachvormittag zum Thema „LGBTIQ+“ für „Trägerverantwortliche und Einrichtungsleitungen“ veranstaltet. Das geht aus einer E-Mail des Caritasverbands, die dieser Zeitung vorliegt, hervor. An diese angehängt waren die Präsentationsunterlagen: 41 Seiten vermeintliche Fakten über „Sexuelle und geschlechtliche Vielfalt“ von der „LGBTIQ+ Beratungsstelle Oberbayern“, welche das „Bayerische Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales“ fördert. Referiert haben Anna Kohlhund, die sich selbst als „queer“ begreift, und Michael Brinkschröder, Fachreferent für Queerpastoral der Erzdiözese München und Freising.
Die LGBTIQ+ Beratungsstelle in Oberbayern berät „erwachsene queere Personen“ und „Personen, die auf der Suche nach ihrer sexuellen und/oder geschlechtlichen Identität sind“ und deren soziales Umfeld sowie „Fachkräfte, die mit queeren Personen und deren Umfeld im Beratungskontakt stehen“. Die Buchstaben im Akronym „LGBTIQ+“ stehen für lesbian (lesbisch), gay (schwul), bisexual (bisexuell), trans* (wer sich nicht oder nur teilweise mit seinem bei der Geburt zugewiesenen Geschlecht identifiziert), inter* (wer sich zwischen zwei Geschlechtern bewegt) und queer (von „questioning“, also fragend). Das „+“ symbolisiert alle nicht aufgeführten „Label“, mit denen Menschen sich womöglich identifizieren, so die einleitende Erklärung.
Die „Gen Z“ ist am häufigsten trans und Co.
Bei Menschen unterschieden sich der „Geschlechtsausdruck“, die „Geschlechtsidentität“, das „Begehren“ und das „biologische Geschlecht“, wie die Sozialpädagogin und psychologische Beraterin Anna Kohlhund auf einer Folie grafisch darstellt. Ungefähr 7,4 bis zwölf Prozent der Deutschen gehörten zur „LGBTIQ+-Community“. Zusätzlich gebe es eine hohe Dunkelziffer. Die sexuelle Orientierung entdeckten die meisten Menschen im Alter von 13 bis 14 Jahren. 22,6 Prozent der Befragten einer Umfrage aus dem Jahr 2015 gaben das an.
Ihre geschlechtliche Identität hingegen fänden die meisten mit unter zehn Jahren heraus, meinten 10,7 Prozent der Befragten, wobei 27,9 Prozent es „schon immer wussten“ und 26,9 Prozent es „nicht so genau“ hätten sagen können. Weiter zeigte eine Statistik aus dem Jahr 2021, dass die sexuelle und geschlechtliche Vielfalt am größten bei den nach 1997 Geborenen ist. In der sogenannten „Gen Z“ sind 32 Prozent der circa 19.000 Befragten aus 27 Ländern nicht „hetero-sexuell“, sondern entweder „transgender, homosexuell, bisexuell, pansexuell, asexuell oder sonstiges“. Bei den zwischen 1946 und 1964 Geborenen trifft das nur auf 13 Prozent der Befragten zu, bei den zwischen 1965 und 1980 Geborenen auf 16 Prozent und bei den zwischen 1981 und 1996 Geborenen auf 22 Prozent.
Gleichgeschlechtliche Partnerschaft angeblich keine Sünde
Zu den LGBTIQ+-Themen beim Synodalen Weg referierte Michael Brinkschröder. Hinter seinem Namen steht in der Mitteilungs-E-Mail in Klammern „er“, damit man weiß, mit welchem Pronomen er angesprochen werden möchte. Der Synodale Weg habe „der katholischen Lehre vom Menschen eine neue Grundlage gegeben“, indem er „homosexuelle Orientierung, transgeschlechtliche Identität und Intergeschlechtlichkeit als natürliche Varianten in die Schöpfungstheologie eingeordnet“ habe. Darum laute die Empfehlung an den Papst, weltkirchliche Verständigung darüber einzuführen, dass homosexuelle Orientierung von Gott mitgeschaffen wurde, steht in der Präsentation. Darunter heißt es: „(Homo-)Sexualität hat ihren Platz in dauerhaften Beziehungen.“ Sie sei an der „Verwirklichung von (…) Liebe, Treue und Verantwortung zu messen“. Daher sei gleichgeschlechtliche Sexualität keine Sünde.
Kirche sei Lebens-, Begegnungs- und Schutzraum für Inter*- und Trans*-Menschen, geht aus einer weiteren Folie hervor. Es gelte, auf die körperliche Unversehrtheit der „inter“ zu achten und den „trans“ keine Konversionstherapien anzubieten. Im Taufregister brauche es die Möglichkeit zum Eintrag „divers“. Seit September 2025 ist die „Queerpastoral“ des Erzbistums München und Freising mit einer halben Stelle für den Fachreferenten dauerhaft eingerichtet, außerdem gibt es 17 „Queerseelsorger:innen“.
Herausforderung: typisch weiblich und typisch männlich
Zu den Aktivitäten gehören beispielsweise, beim Christopher-Street-Day (CSD) in München präsent zu sein, Regenbogenfamilien bei Taufen und Beerdigungen zu unterstützen und Pfarreien für die Belange queerer Menschen zu sensibilisieren. Noch ausstehen würden unter anderem die Segnungen für queere Paare und die Aufarbeitung der kirchlichen Schuldgeschichte.
Zur Herausforderung „Cis-Heteronormativität“ klärt wiederum Kohlhund auf. Zu den „cis- und heteronormative Annahmen“ gehörten: dass es nur zwei Geschlechter gibt, welche sich an den Genitalien erkennen lassen, dass alle Menschen cisgeschlechtlich sind, dass beide Geschlechter sich romantisch und sexuell aufeinander beziehen und alle Menschen sich typisch weiblich oder männlich verhalten. Aufgrund solcher Annahmen fühlten queere Menschen sich diskriminiert und „anders“. 94 Prozent der in Bayern befragten queeren Jugendlichen gaben an, schon mindestens einmal diskriminiert worden zu sein.
Problematisch seien auch geschlechterstereotypische Konsumgüter wie rosafarbene Anziehsachen oder Barbie-Spielzeug für Mädchen und blaue Anziehsachen und Spielautos für Jungen. Schon bei Kindern gelte es, darauf zu achten, „Bewertungen rauszunehmen“ und angemessen zu reagieren, etwa wenn ein Junge mit Rock zur Kita käme. Empfehlenswert sei eine genderneutrale Toilette sowie angemessene Geschenke zum Mutter- und Vatertag für „nicht-binäre Elternteile“.
Keine Geschlechtszuschreibung in der Anrede
In E-Mails an die Eltern solle man genderneutrale Ansprachen benutzen, etwa „Guten Tag Katharina Müller“ statt „Guten Tag Frau Müller“. In die Signatur von E-Mails gehöre das Pronomen, mit dem man sich identifiziere. Darunter könne erklärend stehen, dass die „Geschlechtsidentität von Menschen weder aus ihrem Aussehen noch aus ihrem Namen verlässlich abzuleiten“ sei, man keine Geschlechtszuschreibungen in der Anrede machen und darum gerne erfahren wolle, wie das Gegenüber angesprochen zu werden wünsche.
Folgen der Diskriminierung seien ein höheres Suizidrisiko für lesbische, schwule, bisexuelle, trans*, inter* und queere Menschen, häufige psychische Erkrankungen, selbstverletzendes Verhalten und ein höherer Konsum von Alkohol, Nikotin, illegalen Drogen und Medikamenten sowie ein riskanteres Sexualverhalten. Auch würden die betroffenen Personen häufiger körperlich erkranken; „als Folge von chronischem Stress“ und würden „gesundheitliche Leistungen wegen LSBTI*Q-spezifischen Zugangsbarrieren“ seltener beanspruchen. DT/elih
Die Printausgabe der Tagespost vervollständigt aktuelle Nachrichten auf die-tagespost.de mit Hintergründen und Analysen.