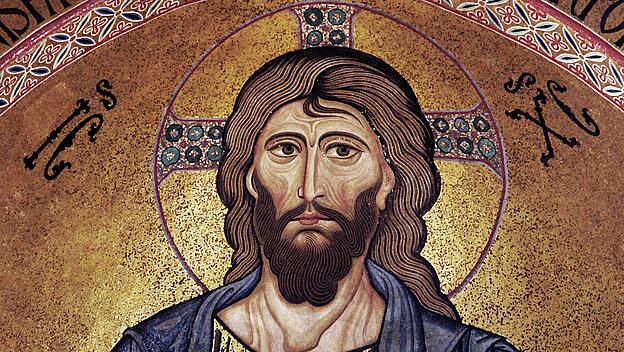Mission ist die ureigentlichste Aufgabe der Kirche, den Menschen Christus zu bringen, und alles, was ihn ausmachte. Dazu gehören Liebe und Barmherzigkeit, insbesondere für die am Rande Stehenden, weshalb das Zentralkomitee der deutschen Katholiken wohl der Ansicht ist, Migration gehöre ins Zentrum der Religion. Damit kratzt das Komitee allerdings nur an der Oberfläche dessen, was den Kern des christlichen Glaubens wirklich ausmacht. Liebe und Barmherzigkeit spielen bei Mission eine Rolle, aber keine alleinige. Nur: Was genau ist Mission, ist Evangelisierung?
Um das begreifen können, hilft der Blick auf die Ursprünge. Christus gab uns den Auftrag: „Geht hinaus in die ganze Welt und verkündet das Evangelium allen Geschöpfen!“ Das klingt nach „Alles stehen und liegen lassen“, beginnt aber tatsächlich vor der eigenen Haustür, sogar im eigenen Herzen. Wovon das Herz voll ist, davon spricht der Mund. Das ist wohl die Essenz dessen, was Evangelisierung meint.
Paulus' Reden wurden begleitet durch Zeichen und Wunder
Paulus ist nach seinem Damaskus-Erlebnis ein beeindruckender Missionar geworden. Er bekehrte sich, erkannte die Wahrheit und stand ab sofort mit Leib und Seele für sie ein. Aber er tat dies nicht allein durchs Predigen. Auch wenn er ein bemerkenswertes Redetalent gehabt hat, überzeugte er seine Zuhörer nicht bloß mit Worten oder Überredungskünsten, sondern sein Reden wurde begleitet durch Zeichen und Wunder — ganz so, wie es auch Jesus zuvor getan hatte.
Dass Heilungen seine Predigten begleiteten, scheint wesentlich. Papst Benedikt XVI. erklärte in seinem Buch „Jesus von Nazareth“: „Heilung ist eine wesentliche Dimension des apostolischen Auftrags und des christlichen Glaubens überhaupt." Das Christentum sei eine Religion der Heilung. „Wenn das auf einer genügend tiefen Ebene verstanden wird, drückt es den ganzen Inhalt der ‚Wiedergutmachung’ aus.“
Jesu Auftrag gilt der ganzen Kirche
Bemerkenswert ist, dass Jesus sich vor seinem öffentlichen Wirken nicht nur taufen ließ - nötig gehabt hätte er, der menschgewordene Gott das nicht. Sondern über ihm wurde, als sich der Himmel öffnete (und nicht wieder verschloss), der heilige Geist ausgegossen; Jesus wurde in seiner menschlichen Natur mit dem heiligen Geist gesalbt, er wirkte in seiner menschlichen Natur Wunder, dazu in Demut und im Gehorsam gegenüber dem Vater im Himmel. Wie er werden seitdem alle Menschen bei der Taufe durch den(selben) heiligen Geist mit Gaben ausgestattet, die sie befähigen zum übernatürlichen Dienst im Reich Gottes unter unter offenem Himmel.
Jesus trug nicht nur den Zwölf Aposteln auf, hinauszugehen, seine Botschaft weiterzutragen, „die unreinen Geister auszutreiben und alle Krankheiten und Leiden zu heilen” (Mt 10,1), wofür er ihnen die Vollmacht (exousia) gab. Er sandte auch „zweiundsiebzig andere aus” (Lk 10,1-9) und erklärte, dass schließlich durch alle, „die zum Glauben gekommen sind“, folgende Zeichen geschehen würden: „In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben; sie werden in neuen Sprachen reden, wenn sie Schlangen anfassen oder tödliches Gift trinken, wird es ihnen nicht schaden; und die Kranken, denen sie die Hände auflegen, werden gesund werden.“ (Mk 16,16-18)
Sogar größere Werke als er würde, wer an ihn glaube, vollbringen (Joh 14,12). Im Klartext: Jesu Auftrag, in seinem Namen die christliche Botschaft in die Welt zu tragen und durch Zeichen und Wunder zu unterstreichen, damit Menschen (wieder) glauben, ist ein Auftrag, der an die gesamte Kirche ergeht — an alle, die glauben. Weit gefehlt also zu behaupten, das würde die Christen heute nicht betreffen.
Gaben wachsen, indem man sie benutzt
Freilich gibt es Unterschiede im Auftrag der Laien und der Geistlichen, durch die Heilungen auch sakramental in Übereinstimmung mit den liturgischen Riten fließen können. Andere mögen ein besonderes Charisma (der Heilung) geschenkt bekommen, so dass durch ihr Gebet im Namen Jesu besonders häufig Krankheiten weichen. Paulus selbst gibt davon Zeugnis.
Aber die Vollmacht, die exousia, über Schwäche und Krankheiten zu gebieten, wie wir im Evangelium lesen, schenkt der Herr jedem Christen im Sakrament der Taufe. Der heilige Cyprian von Karthago schrieb: „Durch diese Gnade (des heiligen Geistes, gegeben in der Taufe), wird uns in aller Reinheit die Kraft gegeben, die Kranken zu heilen, ob an Leid oder Seele, Feinde zu verwöhnen, Gewalt zu unterdrücken, Leidenschaften zu beruhigen, Dämonen zurechtzuweisen…“
Ob eine Gabe des heiligen Geistes dann sichtbar wird, hängt nicht allein davon ab, wo Gott uns hinstellt und wie groß unser Glaube ist, sondern auch, ob wir die Gabe benutzen. Wie die Muskeln nur durch Training stärker werden, so ist es auch mit jeder Gabe Gottes.
Heilungen waren in der Urkirche alltäglich
Heilungen sind übrigens nichts Außergewöhnliches. Zumindest waren sie in der Urkirche noch Alltag und vor allem entscheidend für das exponentielle Wachstum der frühen Kirche. Und es waren ganz gewöhnliche Christen, die im Namen Jesu Wunder wirkten, sodass viele Menschen sich bekehrten, wie es auch der heilige Irenäus schreibt.
Die landläufige Meinung ist nun, dass dies bloß ein Kennzeichen der frühen Kirche war. So dachte selbst der heilige Augustinus, bis ihn das Leben des heiligen Athanasius eines Besseren belehrte und er in seiner eigenen Kathedrale in Hippo zahlreiche Heilungen erlebte. Ende des 4. Jahrhunderts gingen die Heilungen dann zurück, was aber nicht daran lag, dass Gott weniger Wunder wirken wollte.
Irrlehren verdrängten Wunder
Grund mag unter anderen gewesen sein, dass der Glaube an Christus durch Kaiser Konstantin zur Staatsreligion geworden war und Menschen auf einmal auch (soziale) Vorteile einbrachte; nicht alle wurden mehr Christ aus tiefster Überzeugung. Vielleicht wurde auch das zweijährige Katechumenat laxer gehandhabt. Hinzu kamen gnostische und montanistische Irrlehren.
Die eine verachtete alles Leibliche, die andere überbetonte Prophetien und Charismen, sodass es zu einer Gegenreaktion kam. Später verband man übernatürliche Charismen mit Heiligkeit. Die ist aber kein Maßstab dafür, ob Heilungen geschehen, sondern es ist der Glaube. Davon zeugen sowohl die Evangelien als auch Apostelgeschichte.
Gott hat nicht aufgehört, Wunder zu wirken
Heilungen und Wunder ziehen sich durch die ganze Kirchengeschichte — bis heute. Daran zu glauben fällt dem Menschen seit dem Skeptizismus der Aufklärung und dem Wissen um Naturgesetze umso schwerer, auch wenn den meisten Christen klar sein dürfte, dass Gott Urheber aller Gesetze und somit Souverän ist.
Will man Wunder wieder vermehrt sehen, müssen Christen wieder hineinwachsen in ihre Identität als Gottes Kinder, die nichts leisten, sondern nur empfangen müssen. Es ist Gott, der wirkt. Vielleicht kann das Lesen der Evangelien und der Apostelgeschichte den Glauben nähren und Mut machen, entschiedener in die Fußstapfen Jesu zu treten, sich sein Mitleid, aus dem er handelte, zu eigen zu machen, sich mit seiner Liebe für die Menschen zu verbinden und dann erfüllt zu sein von — die Übersetzung Mitleid trifft es nicht ganz — splagchnizomäi, jener starken, inneren Regung, diesem tiefen Getroffensein, das zum Handeln drängt und kühn auch um Heilungen beten lässt.
Ob und wann welche Wunder geschehen, liegt in der Hand Gottes. Unser Auftrag ist es, Gott durch uns wirken zu lassen und ihm keine Grenzen zu setzen. Und wer Wunder erlebt hat, der erzähle davon. Seit Jesu Auferstehung sollen wir sie von den Dächern rufen. Erinnern wir uns an all das Gute, das Gott in unserm Leben täglich tut. Auch das sind oft kleine Wunder. An sie zu denken — was sowohl Glauben als auch Dankbarkeit nährt — lehrte auch der Psalmist: „Gedenkt der Wunder, die er getan hat…“
Die Printausgabe der Tagespost vervollständigt aktuelle Nachrichten auf die-tagespost.de mit Hintergründen und Analysen.