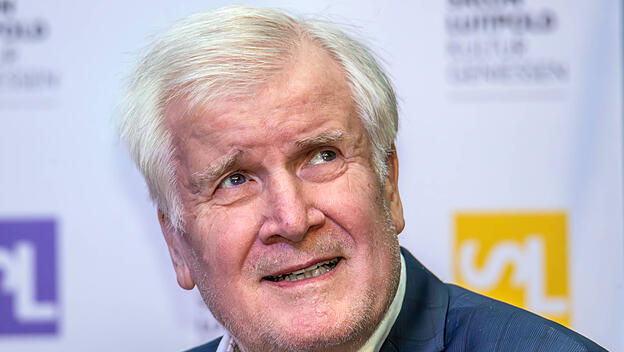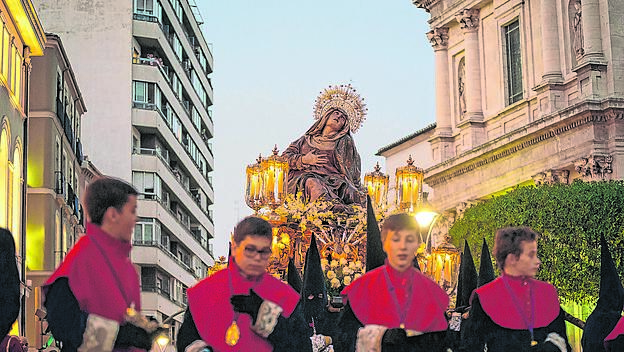Die Caritas-Chefin ist frustriert über die vielen Frust-Debatten. Es müsse in der politischen Kommunikation darauf geachtet werden, dass die, die bei der Bewältigung des Alltags aus welchen Gründen auch immer besonders gefordert und finanziell schlechter gestellt sind, in diesen unsicheren Zeiten nicht noch mehr Angst bekommen, zitiert die katholische Nachrichtenagentur ein Statement von Eva-Maria Welskop-Deffaa. Und erinnert damit unfreiwillig an Thomas de Maizieres unvergessliches Bonmot: „Ein Teil dieser Antworten könnte die Bevölkerung verunsichern“.
Beim damaligen Innenminister ging es 2015 nur um die Hintergründe der Absage eines Fußballspiels. Aktuell hingegen macht sich ganz allgemein die Depression breit. „Vertrauen ins eigene Land dramatisch gesunken“, titelt die „Welt“ aktuell – auch nicht gerade nüchtern. Nach einer Allensbach-Umfrage sei mittlerweile die Hälfte der Bevölkerung der Meinung, dass Deutschland in zehn bis 15 Jahren nicht mehr zu den führenden Wirtschaftsnationen gehöre – vor einem Jahr waren nur 30 Prozent dieser Meinung.
Manchmal ist eine Portion Pessimismus einfach notwendig
Klar, solche Einschätzungen und ihre Verbreitung können zu Angst führen, gerade bei wirtschaftlich Schwächeren. Und sind nicht wenigstens Christen zur Hoffnung, also zur optimistischen Kommunikation berufen? Sollten Katholiken schon aus Glaubensüberzeugung Robert Habeck unterstützen, der Anfang August gutgelaunt Großinvestitionen von Unternehmen in Deutschland ankündigte? Oder sich hinter Bundeskanzler Olaf Scholz stellen, der im Interview mit der Augsburger Allgemeinen verkündete, man solle den „Standort Deutschland nicht schlecht- und uns nicht in eine Krise hineinreden“, während ausgerechnet der Vorsitzende einer C-Partei verlautbaren ließ, das „Prinzip Hoffnung“ sei „zu wenig“?
Defaitismus nervt. Negativberichterstattung zieht die Menschen herunter. Okay. Ab und zu aber ist eine Portion Pessimismus einfach notwendig: nämlich dann, wenn die Aussichten wirklich mies sind. Demographischer Wandel, hohe Energiepreise, wachsende Bürokratie, sinkende schulische Leistungen und defizitäre Sozialversicherungen sind ja keine Produkte der Fantasie, sondern harte Tatsachen. Da kann es nicht die Lösung sein, die Bürger für dumm zu verkaufen. Auch vor der „Agenda 2010“ Anfang des Jahrtausends galt Deutschland als „kranker Mann“. Folge der damaligen Krisenstimmung waren Reformen, die unter Ökonomen als wichtige Erfolgsgeschichte gelten.
Pessimismus muss nicht entmutigend wirken, er kann auch aktivieren. Und was die christliche Verpflichtung zur Hoffnung betrifft: die richtet sich immer noch auf Gott, nicht auf Wirtschaftswachstum.
Die Printausgabe der Tagespost vervollständigt aktuelle Nachrichten auf die-tagespost.de mit Hintergründen und Analysen.