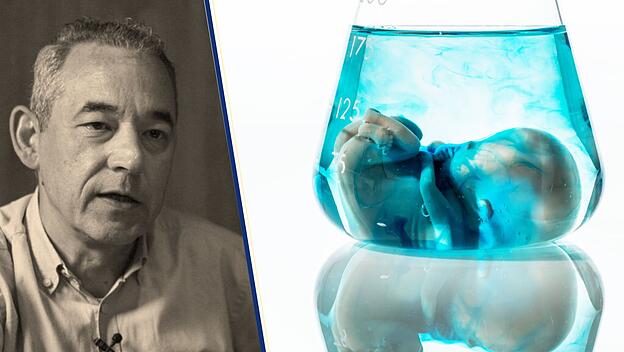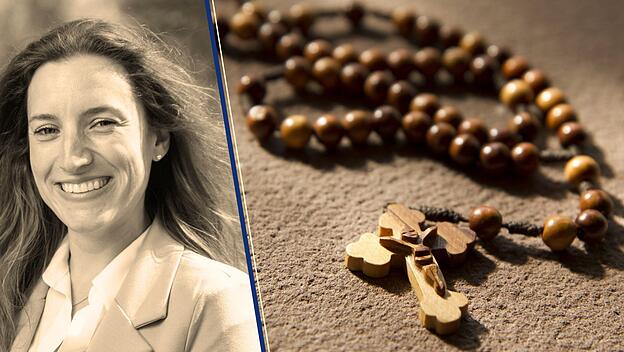Glaubt man Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP), dann wäre die Legalisierung der in Deutschland bislang verbotenen Eizellspende "mit dem Grundgesetz vereinbar". Das mag zwar stimmen. Ganz sicher ist indes: Mit dem Embryonenschutzgesetz (ESchG) ist eine Aufhebung des Verbots der Eizellspende nicht vereinbar; es müsste daher geändert werden. Das ESchG untersagt nämlich die Übertragung fremder Eizellen ausdrücklich. Ihm zufolge wird nach § 1 Abs. 1 Nr. 1 mit "Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe" bestraft, "wer auf eine Frau eine fremde unbefruchtete Eizelle überträgt". Nach § 1 Abs. 2 wird ferner bestraft, "wer 1. künstlich bewirkt, dass eine menschliche Samenzelle in eine menschliche Eizelle eindringt, oder 2. eine menschliche Samenzelle in eine menschliche Eizelle künstlich verbringt, ohne eine Schwangerschaft der Frau herbeiführen zu wollen, von der die Eizelle stammt".
Hauptgrund für diese Verbotsvorschriften ist die Vermeidung der sogenannten "gespaltenen Mutterschaft". Laut dem Abschlussbericht der von der Bundesregierung im Frühjahr des vergangenen Jahres eingesetzten "Kommission für reproduktive Selbstbestimmung und Fortpflanzungsmedizin", deute die "Befundlage zu psychosozialen Aspekten der Eizellspende an, dass die sozio-emotionale Situation der Kinder weitgehend unauffällig ist, ebenso die Eltern-Kind-Beziehung und die psychische Gesundheit der Elternteile". Sowohl das "psychische Wohlbefinden der Kinder" als auch die "Familienbeziehung" scheinen von dem Umstand, dass das Kind mittels einer Eizelle gezeugt wurde, die nicht von der späteren Schwangeren und Gebärenden stammt, nicht beeinträchtigt zu werden. Allerdings müsse, wie die Kommission weiter schreibt, dabei bedacht werden, "dass die wesentlichen Ergebnisse zu den psychosozialen Aspekten der Eizellspende aus letztlich nur zwei umfassenden, methodisch aber hochwertigen britischen Längsschnittprojekten mit vergleichsweise kleiner Teilnehmendenzahl stammen". Dabei handelt es sich einmal um die "European Study of Assisted Reproduction Families" sowie um die "UK Longitudinal Study of Reproductive Donation Families". Während im Rahmen der Ersteren Familien untersucht wurden, deren Kinder 1980 geboren wurden, untersuchte Letztere Familien, deren Kinder rund 20 Jahre später (um das Jahr 2000) geboren wurden. Beide Studien wurden von Arbeitsgruppen der Psychologin Susan Golombok von der Universität Cambridge erstellt. Letztlich steht also die These, eine "gespaltene Mutterschaft" habe keine nennenswerten psychischen Auswirkungen, auf empirisch recht dünnem Eis.
Das Embryo als Fremdkörper
Anders verhält es sich jedoch mit den medizinischen Risiken, die für Kinder bestehen, die mittels einer Eizellspende gezeugt werden. Ein Grund: In der Schwangerschaft interagieren der mütterliche und der kindliche Organismus. Dabei gilt es, sich vor Augen zu halten, dass das Kind bei einer normalen oder natürlichen Schwangerschaft (die medizinische Fachliteratur spricht hier stattdessen lieber von der "spontanen Konzeption") nur zur Hälfte mit der Mutter genetisch identisch ist. Damit das Immunsystem des mütterlichen Organismus den Embryo dennoch nicht als "fremd" erkennt und abstößt, sondern ihn wie eigene Zellen akzeptiert, müssen die kindlichen den mütterlichen Zellen im sogenannten "embryo-maternalen Dialog" gewissermaßen erst einmal beibringen: "Ich gehöre zu Dir. Du musst mich tolerieren." Bei Schwangerschaften, die mittels einer Eizellspende und künstlicher Befruchtung entstanden sind, nimmt das Immunsystem der Mutter den Embryo dagegen vollständig als Fremdkörper wahr. Ein Umstand, der in dem Abschlussbericht der von der Ampelregierung eigesetzten Kommission erstaunlicherweise gar nicht eigens thematisiert wird.
Um den mütterlichen Organismus dazu zu bringen, eine Immuntoleranz zu entwickeln, die ihn für die gesamte Dauer der Schwangerschaft akzeptiert, verfügt der Embryo über Humane Leukozyten-Antigene (HL-A) und regulatorische T-Zellen, die ihm helfen, sich vor der Immunabwehr der Mutter zu schützen. Diese verfügt über sogenannte NK-Zellen (Natürliche Killerzellen), die abnormale Zellen anhand von Veränderungen auf deren Zelloberfläche erkennen. Um den Zustand der Zellen zu überwachen, besitzen NK-Zellen unterschiedliche Rezeptoren. Aktivierende Rezeptoren erkennen beispielsweise Stress- oder Krankheitsmarker, während hemmende Rezeptoren "Selbst"-Marker erkennen und verhindern, dass gesunde Zellen angegriffen werden. NK-Zellen kommen auch im Uterus vor, wo sie dann uNK-Zellen genannt werden.
Diese uNK-Zellen unterstützen unter anderem die Entwicklung der Plazenta, indem sie für die Bildung und Umstrukturierung von Blutgefäßen sorgen und so entscheidend zur Versorgung des Embryos mit Sauerstoff und Nährstoffen beitragen. Auch bei der Schaffung eines immunlogisch toleranten Milieus im Uterus spielen uNK-Zellen eine wichtige Rolle. Laut einer Studie von Kwak-Kim et al. aus dem Jahr 2003 zeigten schwangere Frauen, die eine Eizellspende erhielten, eine signifikant höhere NK-Zell-Aktivität im Vergleich zu Frauen, die auf natürlichem Wege schwanger wurden. Diese erhöhte Aktivität korrelierte mit einer höheren Rate von Fehlgeburten. 2006 haben Moffett und Loke gezeigt, dass auch eine schlechte HL-A-Kompatibilität zwischen Mutter und Kind das Risiko für immunologische Abstoßungsreaktionen erhöht.
Erhöhtes Risiko einer Fehlgeburt
Je nach Studie variiert das Risiko einer Fehlgeburt nach einer Eizellspende zwischen 20 und 40 Prozent, das einer Frühgeburt zwischen 20 und 25 Prozent. Bei Schwangerschaften mit eigenen Eizellen beträgt das Risiko einer Fehlgeburt hingegen 10 bis 15 Prozent, das einer Frühgeburt liegt bei rund 10 Prozent. Mit anderen Worten, Frauen, die nach der künstlichen Befruchtung der Eizelle einer fremden Spenderin schwanger werden, besitzen ein signifikant erhöhtes Risiko für Früh- und Fehlgeburten und zwar allein deshalb, weil der Embryo anders als bei einer "spontanen" Schwangerschaft nicht nur zu 50 Prozent genetisch fremd ist, sondern eben zu 100 Prozent. Erschwerend hinzu kommt, dass die Fertilität von Frauen, die auf die Eizellspende einer anderen Frau angewiesen sind, um mit einem Mann ein Kind im Labor zu zeugen, ohnehin bereits auf die eine oder andere Weise in Mitleidenschaft gezogen wurde.
Dieser Zusammenhang wird in dem Abschlussbericht der Kommission erstaunlicherweise so gut wie gar nicht thematisiert. Seine Autoren beschränken sich vielmehr darauf, festzustellen, dass Frauen, die nach Eizellspende schwanger werden, ein erhöhtes Risiko besitzen, einen Hypertonus (Bluthochdruck) oder gar eine Präeklampsie auszubilden. Die Präeklampsie zählt zu den sogenannten hypertensiven Schwangerschaftserkrankungen, bei denen neben dem Bluthochdruck auch die Schädigung eines oder mehrerer Organe diagnostiziert wurde. Häufig betrifft dies die Leber und/oder die Nieren. Es können aber auch das Gehirn, die Lunge und/oder die Plazenta betroffen sein. Ist Letzteres der Fall, läuft das Kind Gefahr, nicht mehr ausreichend mit Sauerstoff und Nährstoffen versorgt zu werden. Mögliche Folgen sind dann Wachstumsstörungen, Spätschäden sowie Früh- und Fehlgeburten. Auch das wird in dem Kommissionsbericht nicht eigens ausgeführt.
Immerhin wird darauf hingewiesen, dass "Kinder von Müttern, die in der Schwangerschaft einen Schwangerschaftshypertonus oder eine Präeklampsie hatten", mehr "kardiovaskuläre Risikofaktoren" aufwiesen, "als Kinder, deren Mütter keinen Schwangerschaftshypertonus oder eine Präeklampsie hatten". Auch schienen diese Kinder "ein höheres Risiko für Adipositas im Jugendalter zu besitzen". Mütter respektive Eltern sollten daher "über das erhöhte Risiko und mögliche Präventionsprogramme aufgeklärt werden".
Der Natur ins Handwerk gepfuscht
Natürlich können Frauen auch im Rahmen einer "spontanen" Schwangerschaft an Hypertonus oder Präeklampsie erkranken, bisweilen sogar mit völlig identischen Folgen für Mutter und Kind. Allerdings macht es ethisch einen erheblichen Unterschied, ob dafür beispielsweise eine unbekannte genetische Disposition, ein ungesunder Lebensstil oder aber ein mit prinzipiellen Problemen behaftetes Verfahren ursächlich sind. Wer der Natur ins Handwerk pfuscht, um nicht länger unter einem unerfüllten Kinderwunsch leiden zu müssen, der trägt nämlich auch für sämtliche Folgen der von ihm initiierten Prozesse Verantwortung und kann sich nicht darauf zurückziehen, dass eine spontane Konzeption hin und wieder zu dem gleichen Ergebnis führt.
Mag also die Eizellspende mit dem Grundgesetz vereinbar, mögen die psychosozialen Folgen (bei bislang dürftiger Studienlage) auch tatsächlich "unerheblich" sein, die medizinischen Risiken für Mutter und Kind sind es jedenfalls nicht. Wer daher Eizellspenden bewirbt, anbietet oder legalisiert, verantwortet etwas, das er genau genommen überhaupt nicht verantworten kann und wendet dem obersten Prinzip der Medizin, nämlich niemals zu schaden ("nihil nocere"), ohne Rücksicht auf Verluste den Rücken zu.
Die Printausgabe der Tagespost vervollständigt aktuelle Nachrichten auf die-tagespost.de mit Hintergründen und Analysen.