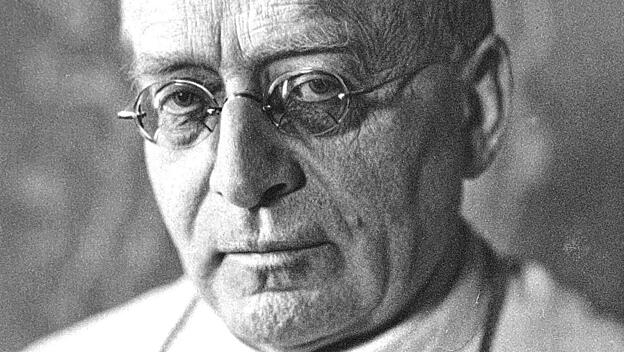Was für eine bewegende Szenerie, was für eine illustre Gesellschaft, die die Besucher im größten Ausstellungsraum empfangen: Sieben mittelalterliche Darstellungen der Muttergottes mit Kind sowie zwei Darstellungen von Heiligen stehen auf Sockeln. Sie sind raumgreifend elliptisch aufgestellt und scheinen miteinander in einem intensiven Dialog vertieft. Worum geht es wohl? Möglicherweise um die Frage nach dem Schicksal des Kindes? Oder um das gleichzeitige Gott- und Menschsein Jesu Christi? An einer der Wände hängt ein elfenbeinernes Kruzifix aus dem zwölften Jahrhundert, das geradezu zu schweben scheint und sich unaufdringlich in den Dialog der Figurengruppe einfügt. Oder geht es doch um „Adam und Eva“, deren Vertreibung aus dem Paradies von Adalbert Trillhaase (1858-1936) in höchst eigenwilliger Darstellung in ein Ölbild gebannt wurde und nun ebenfalls mit den hölzernen Skulpturen korrespondiert?
Es ist ein wunderbares Panorama, das die Kuratoren von Kolumba, dem Kunstmuseum des Erzbistums Köln, nicht nur hier für die neue Jahresausstellung „Artist at Work“ inszeniert haben. Sie bringen bekannte christliche Kunst mit dem Werk eines eher unbekannten Künstlers zusammen, der seine Themen oftmals in der Bibel fand und diese dann in Werke umsetzte, die vom Mittelalter sowie seiner eigenen Zeit inspiriert waren. In der gesamten Ausstellung mit Objekten vom frühen Mittelalter bis in die Gegenwart werden die Besucher eingeladen, sich damit zu befassen, wie Künstler arbeiten, was Arbeit eigentlich künstlerisch macht, wie Kunst an sich entsteht, wo Kreativität herkommt. „Dazu haben wir dieses Mal eine bewusst reduzierte Auswahl von Werken genommen, die das Ergebnis verschiedener Praktiken künstlerischer Arbeitsprozesse sind“, betont Museumsdirektor Stefan Kraus. Sind die vier Steinmetze, die der Kölner Dombaumeister Konrad Kuyn auf einem aus der Mitte des 15. Jahrhunderts stammenden Epitaph wie Gelehrte darstellte, nun Handwerker oder Künstler oder – gemäß des mittelalterlichen Selbstverständnisses – doch Künstler als Handwerker, die in ihren Werkstätten die bestellten Arbeiten realisierten?
Kunst kennt eigene Regeln
Kuratorin Ulrike Surmann ergänzt in diesem Zusammenhang: „Wir wollten auch das Museum selbst und dessen Räume wieder stärker in die Ausstellung miteinbeziehen.“ Ist der Museumsbau von Kolumba vielleicht selbst ein Kunstwerk? Denn das preisgekrönte Haus des Schweizer Architekten Peter Zumthor im Herzen der Kölner Innenstadt gibt dem Team von Kolumba hervorragende bauliche Rahmenbedingungen, um Jahr für Jahr von Neuem in ebenso bewährter wie immer wieder überraschender, eben kreativer und künstlerischer Form thematische Ausstellungen zu konzipieren, die sich an den Werken der eigenen Sammlung orientieren und in wechselnden Kontexten vorgestellt werden.
Die Kunst als ein zur Form gewordenes Spiel mit Inhalten: „Ein Spiel, weil sie es sich leistet, nicht nach vorgegebenen Kriterien zu funktionieren, sondern ihre jeweils eigenen Regeln aufstellt“, betont Stefan Kraus. Dies zeigt sich etwa am Beispiel der „Kugelbahn“ von Manos Tsangaris (geb. 1956). Diese „räumlich installative Komposition für eine Person im Zentrum“, so der Künstler, wird erst dadurch in Gang gesetzt, dass eine Person eine Kugel anstößt. Wird die wie eine Versuchsanordnung wirkende Klangskulptur erst jetzt zum Gesamtkunstwerk? Kein Wunder, dass im Hintergrund das Jesuskind der „Muttergottes mit Kind“ (um 1650) von Jeremias Geisselbrunn (1595-1659) noch anmutiger zu strahlen scheint und die Kugel in seiner linken Hand fest umklammert.
Der Kiosk ist geöffnet
Eine weitere im wahrsten Sinne des Wortes unterhaltsame Installation ist „El Kiosco“. Der inmitten des Ausstellungsrundgangs platzierte Kiosk soll im Rahmen der Jahresausstellung „zu einer Plattform für Begegnungen und für den Austausch unterschiedlicher künstlerischer Arbeitsformen und Praktiken“ werden, betont Kurator Marc Steinmann. An verschiedenen Terminen im Verlauf des Ausstellungsjahres will die Künstlerin Valeria Fahrenkrog den Kiosk situativ bespielen und mit Besuchern dabei in einen offenen Dialog treten.
Neben den aktiven Dialogen, in die die Besucher einbezogen werden oder eingeladen werden, sich einbeziehen zu lassen, sind es die anregenden, mitunter vielleicht auch zunächst verstörenden stillen Korrespondenzen und Dialoge zwischen den ausgestellten Objekten profaner und sakraler Provenienz. So kommen künstlerische Atmosphären und spirituelle Kontexte miteinander in Berührung. Die Skulptur aus Lindenholz „Christus in der Rast“ (um 1480) ist dafür ein Beispiel: Ein von Einsamkeit und Verzweiflung erschütterter und erschütternder Christus hält in Erwartung seines Kreuzestodes einen Moment inne. Sein Blick weist in Richtung des verdunkelten Raumes, in dem sich mit der Installation „Der kleine Pinsel (Menschensuppe)“ von Michael Kalmbach (geb. 1962) eine vollkommen andere Welt als die der Passion des Gottessohnes eröffnet.
Die Frage nach dem Zweck der Kunst
Beide Werke erzählen vom Ringen ihrer Urheber um die inhaltliche Form und Sinngebung, um die Verwendung von Materialien, um das handwerkliche Selbstverständnis. Beide Werke evozieren aber eben auch einerseits die Frage nach Inspiration, Kreativität und Zweck von Kunst. Sie vermögen andererseits aber vielmehr nach einer Antwort auf Sinn und Ziel der menschlichen Existenz an sich zu suchen. Das ist gerade in einem christlichen, respektive katholischen Kunstmuseum von enormer Bedeutung. Schließlich sieht Stefan Kraus in Kolumba, das seit seiner Neueröffnung am heutigen Platz im Jahr 2007 bereits über 900.000 Besucher begrüßen konnte, auch ein „Instrument der Seelsorge“.
Die Ausstellung geht noch bis zum 14. August 2025, und ist jeweils mittwochs bis montags von 12 bis 17 Uhr geöffnet.
Die Printausgabe der Tagespost vervollständigt aktuelle Nachrichten auf die-tagespost.de mit Hintergründen und Analysen.