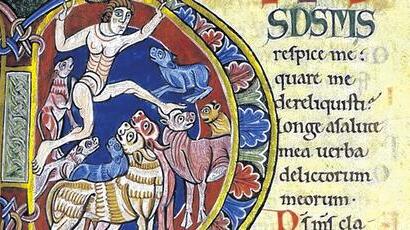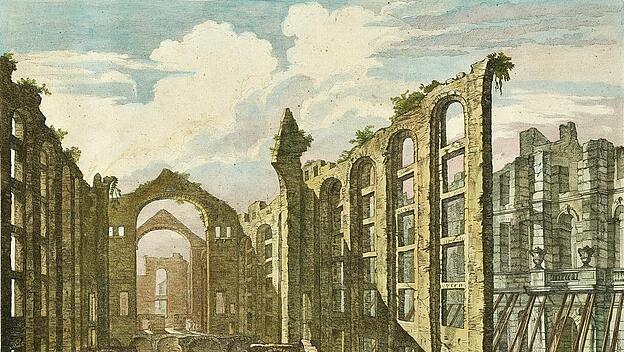Der Berliner Philosoph Wilhelm Schmidt-Biggemann, viele Jahre an der Freien Universität wirkend, hat sich an das Thema heranwagt, das die dritte Frage Kants – „Was darf ich hoffen?“ – beantworten will: die Religionsphilosophie. Er tut dies in historischer Perspektive, aber doch in systematischer Absicht: Schmidt-Biggemann will die „großen Fragen des Glaubens“ mit den Mitteln der menschliche Vernunft so weit wie möglich ergründen und darüber hinaus eine Hoffnung legitimieren, die sich prinzipiell dem Zugriff der Rationalität entzieht.
Theodizeefrage im Zentrum – Vernunft als Trost
Ins Zentrum seiner „philosophischen Theo-Logie“ mit dem sinnfälligen Titel „Gott, versuchsweise“ stellt Schmidt-Biggemann ein altbekanntes Problem: die Theodizeefrage, jene Frage, auf die „Ich weiß es nicht!“ auch in der Master-Prüfung eine richtige Antwort ist. Trotzdem lohnt es sich, die Frage aufzunehmen, zumal, wenn der Topos so systematisch und kenntnisreich durchdrungen wird wie bei Schmidt-Biggemann. Der Verfasser gibt sich nicht mit den Einwänden zufrieden, die darin gipfeln, das Leid der Welt zum „Fels des Atheismus“ (Büchner) zu machen (und den Gottesglauben entsprechend zum Objekt von Spott, Ironie und Hass), sondern er sucht nach Antworten in der Ideengeschichte (Leibniz) und zeigt, dass sich die tiefe Rationalität der Überlegungen zur Gerechtigkeit Gottes nicht einfach durch die Realität der erfahrbaren Ungerechtigkeiten in der Welt negieren lässt. Vernunft und Wirklichkeit sind aufeinander verwiesen: „Die Kontingenzerfahrung ließ die Rationalität nur umso heller leuchten“. Die Vernunft wird zum „Trost“ inmitten einer als leidvoll erfahrenen Wirklichkeit, auch, wenn jene nie ausreicht, diese zu verstehen.
Auch Offenbarung und Sakramente wirken tröstlich
So rational irreduzibel die Realität, so wertvoll ist für ihre Bewältigung die Theologie mit ihren eigenen Kategorien Offenbarung und Sakrament. Schmidt-Biggemann führt überzeugend aus, was die „Verwaltung“ des Heiligen zur Kontingenzbewältigung beiträgt. Damit ist er auch schon bei der Kirche, der er dabei eine ganz praktische Bedeutung zugesteht: sie ist Gemeinschaft der Gläubigen, aber auch die Instanz, die Ketzerei definiert – und damit die Grenzen des vernünftigerweise zu Glaubenden. Sie bestimmt den religiös reduzierten Raum und schafft schon damit Orientierung, aber auch, indem sie bei der Organisation des Kultischen den menschlichen Bedürfnissen Rechnung trägt: „Katholizismus als Institution hält und stützt, wenn die Unio mystica nicht glücken will“. Und das ist ja oft genug der Fall. Im Ergebnis steht bei Schmidt-Biggemann eine Kirche, die zwar die großen religionsphilosophischen (oder Theo-Logischen) Probleme auch nicht endgültig löst, sie aber über alle Zeiten hinweg offenhält und damit die Hoffnung nährt, „es werde schon gut gehen“.
Kurz, aber gehaltvoll: Ein wertvoller Beitrag
Wilhelm Schmidt-Biggemanns essayistischer Einwurf ist kurz, aber gehaltvoll. Wer den Ausführungen des Philosophen folgen will, braucht Konzentration beim Lesen und eine belastbare begriffliche Basis. Obgleich der Verfasser nichts unnötig verkompliziert, ist der Text schwierig. Das Buch eignet sich also eher für den in philosophischen Gedankengängen etwas erfahreneren Leser, der die oftmals nur angerissenen Themen einzuordnen und die zahlreichen gelehrten Anspielungen richtig zu deuten weiß. Für die Religionsphilosophie als akademische Disziplin ist das bei Herder erschienene Bändchen ein wertvoller Beitrag.
DT
Die Printausgabe der Tagespost vervollständigt aktuelle Nachrichten auf die-tagespost.de mit Hintergründen und Analysen. Kostenlos erhalten Sie die aktuelle Ausgabe