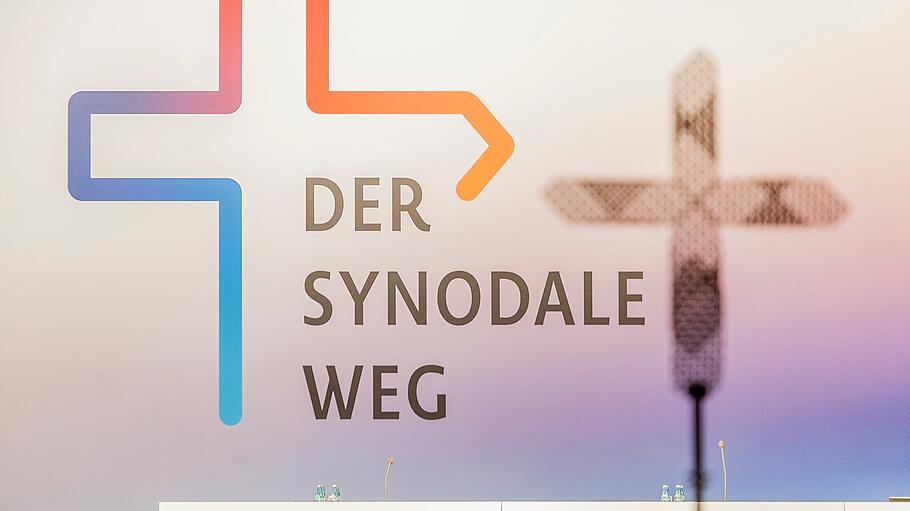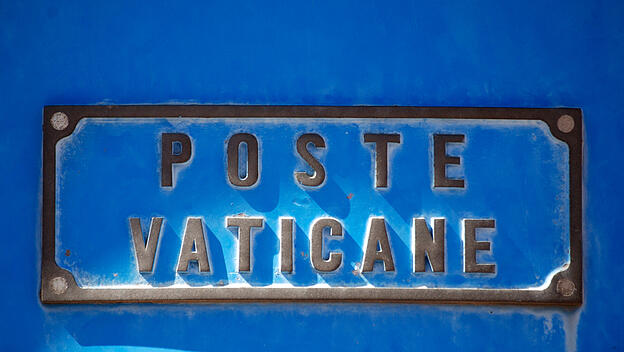Die Laieninitiative "Neuer Anfang" hat, wie sie auf ihrer Webseite mitteilt, als katholische Initiative beschlossen, Licht ins Dunkel der zahllosen Grundsatz- und Handlungstexte zu bringen. Nicht jeder, so die Initiative, habe die Zeit, geschweige denn die fachliche Expertise, um sich durch das Material zu arbeiten. Deswegen habe man Vorarbeit geleistet für alle Interessierten. Sowohl für den Orientierungstext als auch für alle vier Foren des Synodalen Weges liegen jeweils eine Zusammenstellung der wichtigsten Themen und Zitate vor.
Die Initiative hat diese Texte auch gleich in mehrere Sprachen übersetzt. (Englisch, Spanisch und Italienisch.)
Texte sprechen für sich
"Wir lassen die Texte für sich selbst sprechen", betont die Initiative auf ihrer Webseite, das bringe mehr Klarheit und Transparenz als die medialen Interpretationen, die zahlreich kursieren und verbreitet würden. Ferner werden die Texte knapp eingeordnet. Dies sei auf dem Hintergrund der heute gültigen Lehre der Kirche geschehen.
"Lesen Sie einfach selbst nach, was auf dem deutschen Synodalen Weg wirklich beschlossen wird!", ruft die Initiative auf. Die Tagespost dokumentiert die fünf Dokumente sowohl online als auch in einer Beilage zur Printausgabe am 10. November 2022 in voller Länge. Hier im Portal sind die Dokumente mit Links zum Neuen Anfang und mit Links zu dem Originaldokumenten des "Synodalen Weges" versehen.
Macht statt Sakramentalität
Die durchgehende Problematik des Grundtextes besteht darin, dass die „geistliche Vollmacht“ der Schrift mit dem in der Gegenwartsgesellschaft vielfältig diskutierten Begriff der „Macht“ ausgetauscht wird. Der Machtdiskurs wird dann – fixiert ausschließlich auf die katholische Kirche – mit dem Missbrauch von Macht eröffnet. Es werden „systemische Ursachen“ einzig auf klerikale Strukturen projiziert, wobei jede hierarchische Struktur unter Verdacht des Macht-Missbrauchs steht. Aus diesem einen verfehlten hermeneutischen Ansatz folgen weitere Verkehrungen.
Im Text fällt die komplexe Einheit (vgl. „Lumen Gentium“ Nr. 8 „eine einzige komplexe Wirklichkeit“) von geistlicher Wirklichkeit der Kirche und gesellschaftlichem Gefüge auseinander. Die beiden Aspekte werden nur additiv nebeneinandergestellt. Damit wird die für das Konzil grundlegende Sakramentalität der Kirche, in der sich diese Einheit vollzieht, verfehlt. Damit aber auch die Grundstruktur der vom Konzil verbindlich gelehrten Ekklesiologie. Diese grundlegende, verfehlte Weichenstellung bestimmt den Text insgesamt.
Entsprechend wird die in der Sendung begründete komplexe Dialektik von geistlicher Vollmacht und demütigem Dienst im sakramentalen Amt der Kirche ausschließlich von ihrer Missbrauchsmöglichkeit her verstanden. Ja, sie wird anthropologisch und soziologisch auf den Begriff der Machtordnung reduziert und damit in ihrem eigentlichen theologischen Wesen verfehlt. Letztlich identifiziert der Text ganz grundsätzlich die geistliche Vollmacht des Leitungsamts in der Kirche, so wie sie bisher kanonistisch und dogmatisch verstanden wurde, mit einer systemischen Ursache von Missbrauch. Damit werden dem Bischofsamt die theologischen Grundlagen, wie sie LG entwickelt hat, entzogen.
Praktische Konsequenz ist der Versuch, das Problem des Machtmissbrauchs in der Kirche durch „Neutralisierung“ der bischöflichen Vollmacht in auf Dauer angelegten (pseudo-) synodalen Gremien zu lösen. Walter Kardinal Kasper hat darauf hingewiesen, dass solche synodalen Dauergremien keinen Ort in der theologischen Verfassung der Kirche haben. Sie orientieren sich überdies letztlich an Modellen säkularer politischer Ordnungsvorstellungen (Parlament, Gewaltenteilung, „checks and balances“ usw.). Die Komplexität der Beziehungen zwischen politischer Ordnung und der sakramentalen Ordnung kirchlicher Communio wird nur ungenügend wahrgenommen. Ebenso wenig wird das Verhältnis von Hirtenverantwortung und Teilhabe auch nur ansatzweise erkannt. Das „Machtproblem“, das nur geistlich gelöst werden kann, wird letztendlich nur auf Gremien verschoben. Durch die beabsichtigte Neutralisierung bischöflicher Verantwortung wird das Bischofsamt in seiner Substanz beschädigt.
In Forum 1 wirken sich überdies die Weichenstellungen des Orientierungstextes aus. Der Text behauptet ausdrücklich die Möglichkeit einer „Pluralität“ kirchlicher Lehre, die bis zum direkten Widerspruch in wesentlichen Fragen reicht.
Mit der Loslösung der gesellschaftlichen Verfasstheit vom geistlichen Wesen der Kirche und der Behauptung der Möglichkeit einer widersprüchlichen Gestalt der Lehre wird die Pragmatik des Textes deutlich. Wie im Orientierungstext geht es um die Vorbereitung der Revision bisher verbindlicher Lehre bis zur Negation.
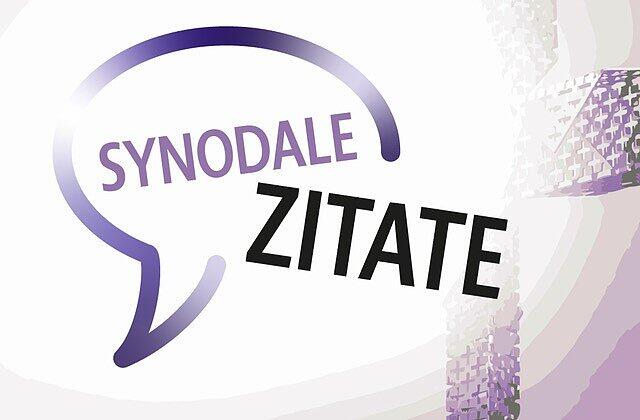
Zitate aus dem Originaltext
(8-12): „Die katholische Kirche steckt in einer tiefen Krise. Sie kann aber ihren Sendungsauftrag nur erfüllen, wenn sie Charakter, Ursachen und Dimensionen dieser Krise erkennt, sich der Krise stellt und ernsthaft an Lösungen arbeitet. Das betrifft vor allem die systemischen Ursachen von Machtmissbrauch und sexualisierter wie geistlicher Gewalt“.
(22-26): „Die Umkehr und die Erneuerung der Kirche betreffen besonders ihre Machtordnung. Denn die Kirche ist gemäß Lumen Gentium 8 eine geistliche Größe, aber sie ist auch eine in dieser Welt verfasste Gesellschaft, weil sie ihr nur so dienen kann“
(31-42): „Der Missbrauchsskandal stellt die katholische Kirche vor die Frage, von welchem Geist sie sich leiten lässt. Eine Antwort auf diese Frage kann nur das ganze Volk Gottes geben. Der Glaubenssinn aller Getauften ruft deshalb nach mehr gemeinsamer Verantwortung, kooperativem Handeln und einklagbaren Beteiligungsrechten. Geteilte Verantwortung schafft nicht zuletzt Transparenz im Gebrauch kirchlicher Macht. Die MHG-Studie hat eindrücklich und in verstörender Vielfalt gezeigt, dass sexualisierte Gewalt von Klerikern an Kindern und Jugendlichen, die Vertuschung von Taten und der Schutz von Tätern nicht nur individualpsychologische, sondern auch systemische Ursachen haben“.
(61-73): „Eine Veränderung der kirchlichen Machtordnung ist aus Gründen gelingender Inkulturation in eine demokratisch geprägte freiheitlich-rechtsstaatliche Gesellschaft geboten. Dabei geht es nicht um eine unkritische Übernahme gesellschaftlicher Praxis; denn die Kirche hat immer auch einen prophetisch-kritischen Auftrag ihren gesellschaftlichen Partnern gegenüber. Aber die demokratische Gesellschaft kann an vielen Stellen die kirchliche Ordnung von Macht nicht mehr verstehen und nachvollziehen. Ja: Die Kirche steht öffentlich unter dem Verdacht, mit ihrer eigenen Rechtsordnung Menschen zu diskriminieren, demokratische Standards zu unterlaufen und sich gegenüber kritischen Anfragen an ihre Lehren und Organisationsstrukturen selbst zu immunisieren“.
(272-281): „Das Zweite Vatikanische Konzil hat die Gläubigen und ihren Glaubenssinn (vgl. Lumen Gentium 12) sowie die ‚Zeichen der Zeit’ (Gaudium et Spes 4) als „Orte der Theologie“ neu herausgestellt: Dazu gehören die Bedeutung extern gewonnener Erkenntnisse für ein tieferes Verständnis des Evangeliums sowie eine zeitgemäße Ausgestaltung kirchlicher Strukturen (vgl. Gaudium et Spes 44). Dazu gehört auch die dialogische Interpretation des Wortes Gottes durch gläubige ‚Laien’, durch die wissenschaftliche Theologie und durch das kirchliche Lehramt. Dieses Gefüge differenziert zu bestimmen, hat Konsequenzen für das Verständnis von Macht und Gewaltenteilung in der Sendung der Kirche, die im Folgenden erläutert werden.“
(287-290): „Gottes Offenbarung ist ein für alle Mal ergangen – doch ihre Aufnahme und Interpretation erfolgen auf menschliche Weise, d. h. im Rahmen geschichtlicher und kulturell bestimmter Verständigungsprozesse, schon in der Bibel.“
(329-333): „Wir wollen theologische Vielfalt in kirchlicher Einheit leben lernen. Pluralität als legitime Vielfalt verschiedener Kernüberzeugungen – auch innerkirchlich Kirche und Theologie waren und sind plural. Vielfalt stellt weder eine Schwäche der Kirche noch ein Führungsversagen der Verantwortlichen dar.“
(343-359): „Das entbindet nicht davon, nach dieser heilsgeschichtlichen Wahrheit in der Unterschiedlichkeit der Zeiten, Kulturformen und konkreten gesellschaftlichen Herausforderungen immer neu zu suchen. Von der einen uns anvertrauten Wahrheit sprechen kann man redlicherweise nur, wenn man um die Komplexität solcher An- und Zugänge weiß und den diskursiven Raum hierfür uneingeschränkt öffnet. Ein solcher ambiguitätssensibler Umgang mit Komplexität ist dem geschichtlichen Charakter der Heilswahrheit geschuldet und erweist sich zugleich gerade heute als Grundsignatur intellektueller Zeitgenossenschaft. Er ist daher Grundvoraussetzung heutiger Theologie. Für sie gibt es nicht die eine Zentralperspektive, nicht die eine Wahrheit der religiösen, sittlichen und politischen Weltbewährung und nicht die eine Denkform, die den Anspruch auf Letztautorität erheben kann. Auch in der Kirche können legitime Anschauungen und Lebensentwürfe sogar im Hinblick auf Kernüberzeugungen miteinander konkurrieren. Ja, sie können sogar zugleich den jeweils theologisch gerechtfertigten Anspruch auf Wahrheit, Richtigkeit, Verständlichkeit und Redlichkeit erheben und trotzdem in der Aussage oder in der Sprache widersprüchlich zueinander sein“.
(415-418): „Ein Sakrament muss Signalwirkung haben! Mit Blick auf die Kirche heißt das: Bedeutsamkeit und Glaubwürdigkeit müssen sich in der Struktur ausprägen (Lumen Gentium 8). Die Machtordnung und -ausübung der Kirche muss sich des Vertrauens der Gläubigen würdig erweisen. … die Rechtskultur der Kirche [muss] an den Grund- und Menschenrechten ausgerichtet werden […]“
(490-496): „Die ekklesiologische Aufgabe, die heute erfüllt werden muss, besteht darin, sowohl im Verständnis des sakramentalen Dienstes als auch im Verständnis wie in der Praxis der Leitungsaufgaben das Zueinander des gemeinsamen Priestertums aller und des besonderen Priestertums des Dienstes neu zu bestimmen. Es kommt darauf an, dass die Communio-Struktur der Kirche zu einer sozialen und rechtlichen Gestalt findet, die einseitige Herrschaftsverhältnisse unmöglich und Partizipationsmöglichkeiten aller verbindlich macht.“
Link zum Original-Dokument:
Forum I
Handlungstext „Gemeinsam beraten und entscheiden“
(Text zur zweiten Lesung vorgelegt, noch nicht abgestimmt)
Die Selbstbindung von Bischof und Pfarrer an Zweidrittel-Beschlüsse ist die Einführung parlamentarischer Gepflogenheiten in die Communio-Struktur der Kirche. Glieder dominieren das „Haupt“, aus der Communio wird ein Consilium (ein Parlament).
Strukturell wird diese Selbstbindung noch verfestigt, indem ein widerständiger Bischof sich einer zweiten Abstimmung unterwerfen muss.
Ist er auch dann noch widerständig wird ein Schiedsgericht einberufen, auf dessen Zusammensetzung er wohl keinen Einfluss hat.
Zitate aus dem Originaltext
„Kommt ein rechtswirksamer Beschluss nicht zustande, weil der Bischof ihm nicht zustimmt, findet eine erneute Beratung statt. Wird auch hier keine Einigung erzielt, kann der Rat mit einer Zweidrittelmehrheit dem Votum des Bischofs widersprechen. Kommt keine Einigung zustande, weil der Bischof auch dieser Entscheidung widerspricht, wird ein Schlichtungsverfahren eröffnet, dessen Bedingungen vorab festgelegt worden sind und an die alle Beteiligten sich zu halten verpflichten. An diesem Verfahren können Bischöfe und Synodale aus anderen Diözesen beteiligt werden.“
Link zum Original-Dokument:
Forum I
Handlungstext „Synodalität nachhaltig stärken: Ein Synodaler Rat für die katholische Kirche in Deutschland“
(Text zur zweiten Lesung auf der 4. Synodalversammlung vom 8. bis 10. September 2022)
Abstimmung: 170 ja, 4 nein, 15 Enthaltungen
Abstimmung anwesende Bischöfe: Stimmberechtigte 59: Ja: 43, Nein: 6, Enthaltung: 10)
Hier wird das Zentralkomitee der Deutschen Katholiken (ZdK) auf die gleiche Ebene von Bischöfen gerückt, obwohl es ursprünglich nur als Laienvertretung gegründet worden ist, um kirchliche Belange gegen staatliche Übergriffe zu verteidigen. Jetzt gewinnt man den Eindruck, dass es „nationalkirchliche Belange“ gegen römische und weltkirchliche Übergriffe verteidigen soll.
Durch die schon im Handlungstext „Gemeinsam beraten und entscheiden“ übernommenen parlamentarischen Strukturen werden schon ortskirchlich, römisch oder weltkirchlich orientierte Bischöfe diszipliniert.
Zitate aus dem Originaltext
(23-36): „Die Synodalversammlung beschließt die Einrichtung eines Synodalen Rates. Die Einrichtung geschieht vor dem Hintergrund von can. 127 und can. 129 CIC. Zur Vorbereitung des Synodalen Rates wird von der Synodalversammlung ein Synodaler Ausschuss eingesetzt. Der Synodale Ausschuss besteht aus den 27 Diözesanbischöfen, 27 vom ZdK gewählten Mitgliedern und 10 von diesen gemeinsam gewählten Mitgliedern. Dieser Ausschuss wird von der Deutschen Bischofskonferenz (DBK) und dem Zentralkomitee der deutschen Katholiken (ZdK) gemeinsam getragen. Er wird von dem Vorsitzenden der DBK und dem / der Vorsitzenden des ZdK geleitet.“
Synodalforum I „Macht und Gewaltenteilung in der Kirche“
Link zum Original-Dokument:
Die Printausgabe der Tagespost vervollständigt aktuelle Nachrichten auf die-tagespost.de mit Hintergründen und Analysen.